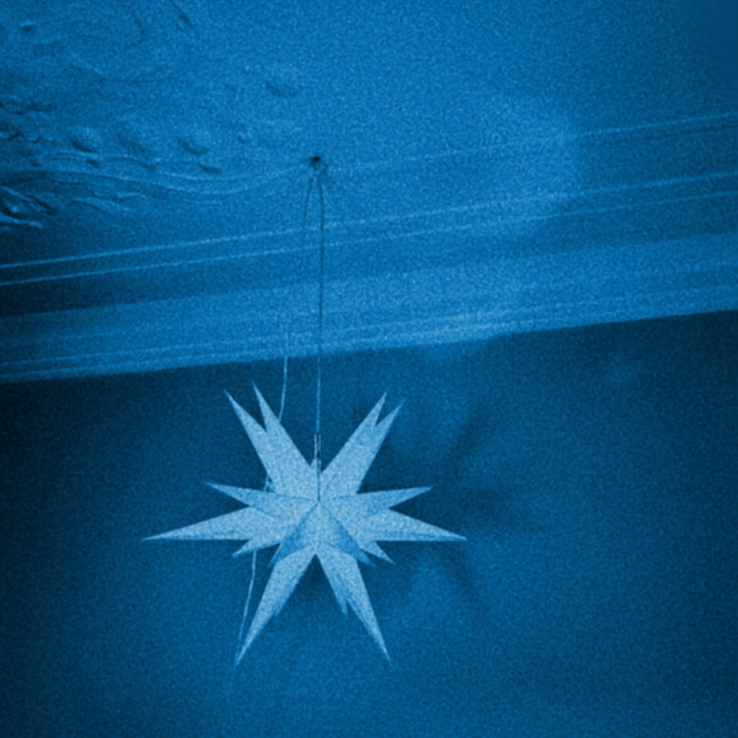Foto: Schauinsblau
von Myriam Kammerlander
Jedes Jahr an Heiligabend fütterte Herr M. die Tauben. Er wusste, dass es unsinnig war, da die Tauben in der Großstadt eher an Fettleibigkeit als an Hunger litten, dass überdies viele die Tauben nicht leiden konnten und daher keinen Sinn darin sahen, ihnen etwas Gutes zu tun. Trotzdem machte er sich, sobald es dämmerte, mit einer Tüte voll Weißbrot auf den Weg zum Domplatz.
Im schwindenden Licht hatten die Häuser erst scharfe und dann immer weichere Konturen, die von den Gaslaternen gelb angestrahlt wurden. Herr M. ging gemächlich, den Stock in der einen und die Tüte mit dem Brot in der anderen Hand, und vermied es dabei, den Leuten in den Häusern allzu offensichtlich in ihre Weihnachtsfenster zu blicken.
Der Platz vor dem Dom war menschenleer. Herr M. setzte sich auf eine Bank, schenkte sich Kaffee aus seiner Thermoskanne ein und wartete. In der Kirche hörte er die Orgel spielen. Eine Weile saß er so und genoss die Ruhe, bis ihm das Merkwürdige auffiel: Es war weit und breit keine Taube da, nicht eine einzige. Kein Gurren, kein Rucken, kein sanfter Flügelschlag. Kein eiliges Tippeln über die Pflastersteine.
Herr M. runzelte die Stirn. Seit er denken konnte, war der Domplatz voller Tauben gewesen. Mit ihrem geschäftigen Ruckediguh liefen sie einem direkt vor die Füße und kackten den Statuen verdienstvoller Männer der Stadtgeschichte auf den Kopf.
Das war das Einzige gewesen, was Inge an den Tauben gemocht hatte. Dass sie sich nicht darum kümmerten, wer wichtig und wer unbedeutend war. Sie gingen einfach allen auf die Nerven und waren darin äußerst gerecht. Über seine sentimentalen Anwandlungen hatte sie den Kopf geschüttelt. Trotzdem hatte sie in den letzten Jahren ihrer Ehe das Brot für ihn und seine Tauben geschnitten, feiner als er es je zustande gebracht hätte. Sie hatte die Tüte auf den Küchentisch gestellt und eine Kerze daneben. „Du kannst ja noch zum Friedhof gehen.“ Darüber wiederum hatte er manchmal den Kopf geschüttelt und Inge sentimental gefunden. Glaubte sie wirklich, dass es einen Unterschied machte, ob da nun eine Kerze flackerte oder das Grab dunkel blieb? Trotzdem war er ihr zuliebe nach seinem Taubengang auf den Friedhof gestapft. Während er unterwegs war, putzte Inge zu Hause letzte Flecken weg, die für sein Auge unsichtbar waren. Wenn er zurückkam, entzündeten sie gemeinsam die Kerzen und dann saßen sie mit Punsch am Küchentisch und schauten den winzigen Weihnachtsbaum an.
Mit den Jahren war das Bäumchen immer kleiner geworden. Seit Thomas verunglückt war, hatten sie niemanden mehr, für den sich das ganze Brimborium lohnte. Aber Inge wollte einen Weihnachtsbaum. So holten sie Jahr für Jahr einen im Wald. Einen kleinen. Sie gingen mit einem Picknickkorb hinaus, immer zur selben Lichtung. Dort, wo sie ihr Bäumchen schlugen, streuten sie Körner für die Waldvögel. Dann setzten sie sich noch ein Weilchen hin und tranken Kaffee auf einem umgefallenen Baumriesen, der von Jahr zu Jahr von dichterem Moos bewachsen war. Während es um sie herum allmählich dämmerte, warteten sie darauf, dass ihre Gaben entdeckt wurden. Manchmal hatten sie Glück und lauschten dann still dem sanften Flattern und Flügelschlagen. Sie trugen den Baum nach Hause und dachten, es hätte schlechter kommen können. Bis irgendwann Inges Beine einfach unter ihr nachgaben. Inge war hart im Nehmen, doch an diesem Abend weinte sie. Sie hielt das Bäumchen fest an die Brust gepresst, während er sie huckepack, über Wurzeln und Äste nach Hause schleppte.
Statt in den Wald gingen sie nun auf den Markt und kauften ein Bäumchen, das so klein war wie seine Rente. Sie stellten es mitten auf den Küchentisch. Inge befestigte drei Kerzenhalter daran, zwei gläserne Vögel und ein paar Strohsterne und sie versicherten sich, dass es immer noch ein sehr schöner Weihnachtsbaum sei.
Danach fing das mit dem Taubenfüttern an. Sie konnten ja nicht den ganzen Nachmittag zusammen zu Hause hocken. Wenn Heiligabend dann endlich kam, waren sie hoffnungslos zerstritten. Inge dabei zuzusehen, wie sie durch die Wohnung humpelte und den Besen schwang, machte Herrn M. nervös. Er hatte versucht es ihr auszureden, doch sie war stur wie eh und je. Er hatte versucht ihr zu helfen, aber sie machte dann alles nochmal neu. Spätestens wenn sie die Leiter herauszerrte, weil sie im obersten Winkel des Küchenfensters noch einen Fleck entdeckt hatte, musste er unbedingt an die frische Luft. So entstand ihre Arbeitsteilung. Er ging zu den Tauben und danach auf den Friedhof. Sie machte die Wohnung schön, polierte Thomas‘ Bild, und wenn alles blitzte und blinkte, kam er nach Hause und es war Weihnachten. Sie zündeten die Kerzen an und dachten, alles in allem hätte es schlechter kommen können.
Bis zu diesem Jahr, als Inge sich verschätzte. Sie hatte nur noch die Vorhangstange gerade rücken wollen. Nur noch diesen einen Stern daran befestigen wollen, der immer so schön für ihn leuchtete, wenn er wiederkam, auch wenn sie nicht wusste, ob er ihn jemals bemerkte. Sie hatte sich nur ein klein bisschen zu weit nach vorne gelehnt, hatte die Leiter nicht noch einmal verrückt, weil die Schmerzen in der Hüfte mit jedem Auf- und Absteigen unerträglicher wurden. Sie hatte ihm nie gesagt, wie unerträglich die Schmerzen in Wirklichkeit waren, weil er sonst darauf bestanden hätte, selbst hinaufzusteigen, ihr zumindest die Leiter zu halten, die Leiter am Ende gar versteckt hätte. Sie brauchte das Gefühl, dass sie noch unabhängig auf eine Leiter steigen konnte. Und sie brauchte unbedingt diese zwei Stunden allein mit Thomas, bevor Weihnachten kam.
Als die Welt um sie herum unaufhaltsam verrutschte, hatte sie versucht, sich an der Vorhangstange festzuhalten. Mit dem Stern in der einen und der Vorhangstange in der anderen Hand ging sie zu Boden, wo Herr M. sie fand. Er hatte keinen Stern im Fenster gesehen. Mit bösen Vorahnungen und schwer atmend war er die Treppe hinaufgeeilt und kam doch zu spät. „Hans“, sagte sie schwach.
Jedes Jahr an Heiligabend fütterte Herr M. die Tauben. Er wusste, dass es unsinnig war. Doch für ihn war es das nicht. Sobald es dämmerte, machte er sich auf den Weg zum Domplatz. Mit einer Tüte Weißbrot, das er so fein geschnitten hatte, wie er eben konnte. Zu Hause wartete der Weihnachtsbaum. Einer im Topf. Er hatte ihn mit drei Kerzen und zwei gläsernen Vögeln geschmückt. Er würde die Kerzen anzünden und sich mit einer Tasse Punsch an den Tisch setzen. Nur den Stern hängte er nicht mehr auf. Wenn er nach Hause kam, versuchte er, nicht nach oben zu blicken, wo das Weihnachtsfenster dunkel blieb seit dem Sturz.
In den letzten Jahren hatte er stattdessen angefangen, die Sterne zu zählen, die andere Leute in ihre Fenster hingen. Er wusste nicht, warum er das tat. Auf eine Weise fand er es tröstlich, dass es in der Stadt auf dem Weg zum Domplatz fünfundsechzig leuchtende Sterne gab. Fast war es, als würde ihr Licht ihm gelten. Und gewissermaßen war das ja auch so. Ihr Licht galt allen, die zufällig vorbeikamen, ob das nun jemand Wichtiges war oder jemand Unbedeutendes wie er.
Herr M. trank seinen Kaffee aus. In der Kirche verklang die Musik. Er hörte, wie das Portal geöffnet wurde. Wie jedes Jahr postierten sich dort zuerst die Ministranten mit ihren Körbchen für die Kollekte. Bald würden die Leute herausströmen und der Platz wäre voller Leben.
Die Tauben waren nicht gekommen. Herr M. schraubte den Becher auf die Thermoskanne und erhob sich umständlich. Er strich seinen Mantel glatt, pustete in die kalt gewordenen Finger. Er verstaute die Kanne in der weiten Manteltasche neben der Kerze. Mit der Brottüte in der einen und dem Stock in der anderen Hand schritt er steifbeinig, doch würdevoll über den Platz und merkte gar nicht, dass die Ministranten einander anstießen und auf ihn deuteten: Da ist der Alte wieder.
Auf dem Friedhof war es still. Hier und da flackerten Kerzen auf den Gräbern. Ihr Licht fiel auf zerfallende Gestecke, Engel und Täfelchen, auf denen Dinge zu lesen waren wie „Ich vermisse dich“ oder „Unvergessen“. Thomas‘ Platz hatte damals Inge ausgesucht, während Herr M. zu nicht viel in der Lage gewesen war. Ganz hinten versteckt, zwischen Mauer und Hecke. Eine Bank gab es dort, auf der man in Ruhe sitzen konnte.
Herr M. ging mühsam in die Hocke. Auf dem Grab wuchs ein kleiner Hagebuttenstrauch. Er hängte die Strohsterne hinein, stellte die Kerze in die Halterung und zündete sie mit zittrigen Fingern an. Mit einem Rest Kaffee setzte er sich auf die Bank und hielt die Brottüte im Schoß. Das Kerzenlicht fiel auf das kleine Täfelchen, auf dem nur die beiden Namen standen. Das reichte, fand Herr M. An alles andere konnte er sich erinnern.
Als er aufblickte, stand Inge neben ihm. „Da bist du ja“, sagte sie. Er wunderte sich, aber nur kurz. Sie setzte sich. Er reichte ihr den Becher. Sie nahm einen Schluck. Dann deutete sie auf seine Brottüte. „Die Tauben waren heute gar nicht da“, sagte er. Inge sah ihn freundlich an. „Heute ist doch Weihnachten“, fügte er wie zur Erklärung hinzu. Sie lächelte und griff in die Tüte. „Ich habe dir leider nichts Besseres mitgebracht“, sagte er entschuldigend. „Dafür habe ich es so fein geschnitten wie ich konnte.“ Inge lächelte wieder. „Komm“, sagte sie, „füttern wir die Tauben.“ Sie streuten die Brotkrumen auf den Kiesweg vor sich, um das Grab herum, auf das Grab, auf die Bank neben sich. Sie warteten. Und da hörten sie: Ein Flattern, ein Flügelschlagen. Inge und Herr M., der schon lange nicht mehr Hans geheißen hatte, blickten auf und sahen: Hunderte Tauben. Mit ihrem geschäftigen Ruckediguh tippelten sie eilig über den Kiesweg und ihnen direkt vor die Füße. Sie flatterten auf die Bank und auf den kleinen Grabstein. Sie pickten die Brotkrumen vom Grab und probierten auch die Strohsterne und die Hagebutten. Sie hockten ihr auf dem Schoß und kackten ihm auf den Hut. Hans und Inge lachten, schauten und hielten sich an den Händen wie einst.
Am Morgen des ersten Weihnachtstages fanden Friedhofsgänger Herrn M.
Er saß auf der Bank, der Kopf war auf die Brust gesunken. Sein Ellbogen ruhte auf der Lehne, fast so, als hielte er jemanden im Arm. Auf dem Schoß hatte er eine leere Papiertüte, neben ihm stand der kalt gewordene Kaffee. Um ihn herum lagen verstreut ein paar Brotkrumen. Eine Taube hatte ihm auf den Hut gekackt.
Die Frau sah ihn zuerst. Sie sprach ihn an, berührte ihn vorsichtig an der Schulter.
„Es gibt so viel Einsamkeit an Weihnachten“, sagte sie traurig.
„Er sieht eigentlich ganz friedlich aus“, sagte der Mann und legte den Arm um sie.

Myriam Kammerlander wurde 1988 in München geboren. Als Musikerin und freie Kulturschaffende, nach Wanderjahren zwischen Künsten und Handwerk, zwischen Berlin, Skandinavien und Alpen lebt sie nun in Augsburg, wo sie Umweltethik studiert und die Bayerische Akademie des Schreibens absolviert hat. Sie interessiert sich für die Verbindungen von Kreativität und Gemeinschaft, Natur und Poesie, und erforscht die regenerative Kraft von Kunst. Im Schreiben beschäftigt sie, wie das Vergangene in die Gegenwart hinein und durch sie hindurch leuchtet.