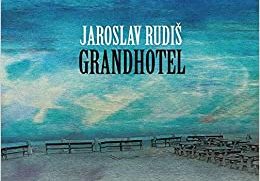Ein Gespräch mit Lydia Daher
von Nicole Seibert und Svenja Kärting
Singende Schauspieler sind heutzutage keine Seltenheit mehr. Singende Lyriker schon. So ist die Wahlaugsburgerin Lydia Daher längst nicht mehr von den internationalen Bühnen wegzudenken. Im Zentrum ihres Tuns steht stets das Wort, auf ihren Touren vereint sie Lieder mit Dichtung. Im Interview mit Schau ins Blau spricht die Preisträgerin des Bayrischen Kunstförderpreises über ihre Befürchtung, dass die Lyrik mehr und mehr an Bedeutung verliert und wagt einen Blick bis in die Weiten des Universum.
SCHAU INS BLAU: Frau Daher, Sie sind als Grenzgängerin zwischen Literatur und Musik äußerst erfolgreich: 2012 wurden Sie mit dem Bayrischen Kunstförderpreis für Ihr lyrisches Werk ausgezeichnet und Ihr Musikalbum Flüchtige Bürger stieß auf großen Anklang und Begeisterung im Musikfeuilleton. Wie lässt sich der Zusammenhang zwischen Musik und Literatur beschreiben? Kann man die Musik vielleicht als Ausweg aus dem Alltag des Schreibens sehen?
LYDIA DAHER: Tatsächlich habe ich so mit der Musik angefangen – es war ein Ausweg. Mir war es damals, als ich im Sommer 2006 mein erstes Album aufgenommen habe, eine Zeit lang schlicht zu anstrengend, in der Hitze vor dem weißen Blatt Papier zu sitzen und Gedichte zu schreiben. Und dann habe ich angefangen Lieder aufzunehmen. Das war zu der Zeit sehr befreiend. Nicht so still, und vor allen Dingen nicht an Erwartungen geknüpft. Und so fern lag es schließlich nicht, Songtexte und Musik zu schreiben und sie aufzunehmen, immerhin ist jede Form der Dichtung in einem bestimmten Maß an Klang und Rhythmik gebunden.
SCHAU INS BLAU: Klang und Rhythmik konnten vor allem in den Anfängen der Lyrik, im mündlichen Vortrag vermittelt werden. Geht der Trend dahin zurück? Erklären Sie sich damit den Erfolg von Lyrik-Festivals und Poetry-Slams in der heutigen Zeit?
LYDIA DAHER: Das muss man natürlich alles auseinander dividieren. Poetry Slams sind sehr erfolgreich, weil sie ein literarisches Event-Format sind, bei dem alle Leute mitmachen können: sowohl das Publikum als auch jeder, der schreibt. Das ist im etablierten Literaturbetrieb anders: Bei einer Lesung in einem Literaturhaus fehlt dieser Event-Charakter und folglich kommen auch weniger Leute. Zum letzten Finale der German International Poetry-Slam-Meisterschaft kamen über 4000 Zuschauer, das würde man bei einer Lesung niemals zusammenbekommen. Basis in beiden Bereichen ist natürlich das Wort. Aber man darf sie nicht in einen Topf werfen. Sowohl das Handwerkliche, also das Schreiben, funktioniert anders, als auch die Verbreitung und die Rezeption. Es gibt natürlich auch im klassischen Lyrikbereich sehr viele Leute, die schreiben, aber eben nur wenige, die publizieren. Es wird ziemlich ausgesiebt, leider auch weil sich mit der Poesie nicht viel Geld verdienen lässt.
SCHAU INS BLAU: Es ist schade, dass die Lyrik trotz dieses scheinbaren Erfolgs mit Poetry-Slams, mehr und mehr an Bedeutung verliert. Haben Sie vielleicht ein eigenes Patentrezept entworfen, um dieser Tendenz ein wenig entgegen zu wirken?
LYDIA DAHER: Es ist immer meine Hoffnung, dass man – auch jenseits des Poetry Slam – mehr offene Ohren für die Lyrik gewinnen kann. Vielleicht hilft mir dabei manchmal dieses Grenzgängertum: Wenn ich beispielsweise Konzerte spiele, baue ich sehr oft auch Gedichte ins Programm mit ein, um die Leute ein wenig einzufangen; ganz nach dem Motto „Jetzt sind sie da, jetzt müssen sie sich eben Gedichte anhören!“ Und die meisten merken dann, dass es gar nicht so schlimm ist, wie sie dachten oder wie sie es in Erinnerung hatten. Manchmal mache ich wirklich einen ganz harten Schnitt und unterbreche für 20 Minuten die musikalische Darbietung. Ich setze mich dann an einen Tisch und lese Gedichte vor, teils mit, teils ohne Band als musikalischen Background. Bei den meisten Leuten spielt die Lyrik im Leben oder im Alltag keine Rolle. Und dann passiert es plötzlich doch, dass die Leute sagen: „Das ist der erste Lyrikband, den ich mir kaufe.“ Es freut mich, wenn ich damit einen Anstoß geben kann.
SCHAU INS BLAU: All Ihre im Lyrikband veröffentlichten Gedichte vermitteln ein so eindringliches poetisches Bild, dass sie den Anspruch erfüllen, auch selbst gelesen, ihre volle Wirkung zu entfalten. Sie lassen Außen- und Innenwelt verschmelzen. Ihr Klang trägt uns förmlich durch eine Welt, mit der wir uns zu arrangieren versuchen. Und dennoch ist das Gedicht für Sie „kein Ort,/ an dem wir uns treffen“ (S.76) wie es in Ihrem Gedichtband Insgesamt so, diese Welt (2012, Voland & Quist)? Wollen oder können wir uns nicht treffen?
LYDIA DAHER: Zu meiner Arbeit gehört, dass ich immer wieder alles hinterfrage. Und das Hinterfragen bezieht sich dann wiederum auf meine eigene Arbeit: Warum mache ich das Ganze, habe ich mit dem, was ich hier tue, überhaupt eine Chance eine Verbindung zwischen mir und dem Leser herzustellen? Dieses Gedicht ist eine Reflexion – oder vielleicht auch ein kleiner Seitenhieb – darüber, dass wir uns als Lyriker zwar bemühen, aber uns niemals sicher sein können, ob wir irgendwas oder irgendwen wirklich treffen können, auch im Sinne von berühren. Ulrike Almut Sandig, eine deutsche Lyrikerin und Prosaistin, schrieb über das Gedicht, dass es Rock ’n’ Roll sei. Ich führe die eigenen Worthülsen vor, spreche von der Lächerlichkeit des Dichtens an sich und davon, wie gottverlassen wir darin eigentlich sind. Und doch: Es ist eine Lächerlichkeit, die hoffnungsvoll ist, die ich sehr ernst nehme. Ich schreibe ja schließlich weiter.
SCHAU INS BLAU: Ihre Gedichte sind häufig von den Motiven der Verlassenheit, Vergänglichkeit, Rastlosigkeit und Undeutlichkeit gezeichnet. Vergeblich ist dabei die „Suche nach/ Dingen, in denen die Ruhe/ der Eindeutigkeit liegt“ (S. 60). Dient dann ein Perspektivenwechsel als rettender Ausweg? Vielleicht ein Blick vom Perlachturm nach oben in den Himmel, zu den Sternen?
LYDIA DAHER: Ein Perspektivenwechsel ist natürlich immer wichtig. Da sind wir wieder beim Hinterfragen: Wo befinde ich mich und wo befinde ich mich im Verhältnis zu allem anderen? Die Ruhe der Eindeutigkeit liegt in dem Gedicht in ganz konkreten Dingen, im Konsum, in dem, was greifbar ist. In meiner Arbeit oder in dem, was ich schätze – zum Beispiel Literatur oder Musik –, sind es die nicht greifbaren Dinge, die Wert haben. Außerhalb der Materie lässt sich der Wert aber nur subjektiv bestimmen. Was für einen Wert hat diese Zeile, dieses oder jenes poetische Bild? Da steht kein Etikett drauf: 7,50 €. Oder so. Das Unkonkrete macht es unsicherer – aber auch spannend.
SCHAU INS BLAU: Welche Wechselwirksamkeit zwischen dem ungreifbaren bestirnten Himmel und Ästhetischem vermuten Sie in diesem Zusammenhang? Können durch diese Verhältnisse tatsächlich neue transkulturelle Erzählformen entstehen?
LYDIA DAHER: Ein Gedicht ist vielleicht so etwas wie das All in Miniatur. Das Spektrum an Möglichkeiten ist unendlich; es kann nicht wirklich gesagt werden, wie ein gutes Gedicht funktioniert. Wo kommt es her, wo strebt es hin? Es gibt natürlich die Germanisten, die über die Dichtung viel Theoretisches wissen, aber trotzdem gibt es keinen Masterplan. Ich kann experimentieren, ich kann lernen, und ich kann versuchen, gewissen Dingen näher zu kommen, aber wie das funktioniert, wann das passiert und was es da noch für Schritte in meiner Laufbahn gibt – keine Ahnung. Alles Wissen darüber ist nur temporär, fragmentarisch, eigentlich nichts. Und doch ist da der Glaube, dass die Dichtung der Zugang zu einer Art universeller Erfahrung der so genannten Wirklichkeit sein kann.
SCHAU INS BLAU: Ist es ein Problem der Kunst, dass viele Dinge – gerade um All und Kosmos – mittlerweile sehr klischeehaft aufgegriffen werden?
LYDIA DAHER: Das birgt einerseits natürlich eine große Gefahr. Andererseits ist es auch eine schöne Herausforderung, weil schon viel darüber gesagt wurde und so vieles mittlerweile Plattitüde ist, wenn man es ausspricht oder – noch schlimmer – aufschreibt.
SCHAU INS BLAU: Sie haben aus Ihrem Gedichtband Insgesamt so, diese Welt (2012, Voland & Quist) explizit zwei Gedichte für unser Magazin ausgewählt, die einen deutlichen Zusammenhang zwischen Individuum und Kosmos zeigen. Wirken stellare Konstellationen allgemein inspirierend?
LYDIA DAHER: So würde ich das nicht sagen. Für mich war es für diese Gedichte richtig. Aber für jemand anderen, der gerade an einem anderen Text schreibt, ist es vielleicht kein passendes Motiv. Ich für meinen Teil finde es total spannend und interessant, dass man – wie beispielsweise in meinem Text „Testgelände, Tagesmeldung“ – mit wenigen Zeilen einen so großen Bogen spannen kann. Von einem Küchentisch bis ins Universum und wieder zurück. So öffnet man einen riesigen Raum. Sich nicht darin zu verlieren, ist auch nicht so einfach, aber es ist eine schöne Sache, wenn es funktioniert.
SCHAU INS BLAU: In Ihrem Text Testgelände, Tagesmeldung heißt es „Und ist es nicht merkwürdig,/ dass ausgerechnet wir/ hier sitzen, unter den vollen Regalen des Himmels,/ mit wohlsortierten Bewegungen, in diesem/ besonders privilegierten Universum,/ in dem es Radios gibt/ und Samstagnächte?“ (S. 19) – eine besonders auffällige Wechselwirksamkeit zwischen Individuum und Kosmos. Die Unendlichkeit des Kosmos steht der determinierten Verbindung des Individuums zum selbigen gegenüber. Welchen Reiz übt dieses Verhältnis aus? Vermag die Poesie der individuellen Eingebung der Bedürftigkeit nach dem Himmel zu folgen oder hilft sie einen reflektierenden Zusammenhang zu konstruieren?
LYDIA DAHER: Das hängt natürlich immer von der Situation ab und von dem, was man in einem Text ausdrücken möchte. Der Himmel kann mal Hoffnung spenden und mal bedrohlich sein. Kann offen sein, oder verschlossen. Die Unendlichkeit oder das Denken an die Unendlichkeit kann einen vielleicht beruhigen, kann einen aber auch total beängstigen – je nachdem, wo man selbst gerade steht. Ich glaube pauschal kann man das nicht sagen.
SCHAU INS BLAU: Kann man letztlich sagen, dass eine gewisse Himmelskonstellation Sie als Individuum bestimmt und zum Künstlersein beiträgt?
LYDIA DAHER: Ich weiß nicht, was mich bestimmt. Also würde ich jetzt auch nicht behaupten, dass mich irgendwas im Himmel bestimmt, oder dass Himmelskonstellationen zum Künstlersein beitragen. Was trägt denn zum Künstlersein bei? Ich weiß nicht: Wenn man davon leben will, trägt auf jeden Fall viel Arbeit bei. Das ist das romantische Bild, das ich hier auf keinen Fall abgeben will: Ich laufe nachts durch die Gegend und schaue mir die Sterne an und dann gehe ich nach Hause und schreibe bei Kerzenlicht ein Gedicht… So ist das einfach nicht.
SCHAU INS BLAU: Ein schöner Schlusssatz. Wir würden sagen, damit sind wir wieder auf dem Boden der Tatsachen, fern von Sternen und unendlichen Weiten, angelangt. Vielen Dank für dieses spannende und sehr inspirierende Interview!

Die Lyrikerin und Musikerin Lydia Daher, wurde 1980 in Berlin geboren, wuchs in Köln auf und lebt heute in Berlin. Sie arbeitet allein oder gemeinsam mit anderen Künstlern auch im Bereich der Bildenden Kunst und des Hörspiels (z.B. BR Hörspiel und Medienkunst). Regelmäßig kuratiert sie spartenübergreifende Kulturveranstaltungen (z.B. Brechtfestival Augsburg) und ist als Dozentin für kreatives Schreiben tätig. Ihre Arbeiten wurden vielfach in nationalen und internationalen Zeitschriften und Anthologien publiziert und mit Preisen und Stipendien ausgezeichnet (z. B. Bayerischer Kunstförderpreis). Ihre Musikalben werden vom Münchner Indielabel Trikont veröffentlicht. Im Auftrag des Goethe-Instituts reiste sie u. a. nach Hongkong, Algier, Warschau und Moskau. Zuletzt erschienen diverse Kollaborationsarbeiten, beispielsweise die EP „Algier“, die Broschüre „Kleine Satelliten“ (Zeichnungen: Warren Craghead III) und zusammen mit dem Münchner Fotograf Gerald von Foris das Foto-Text-Buch „Frisches Trauma“.