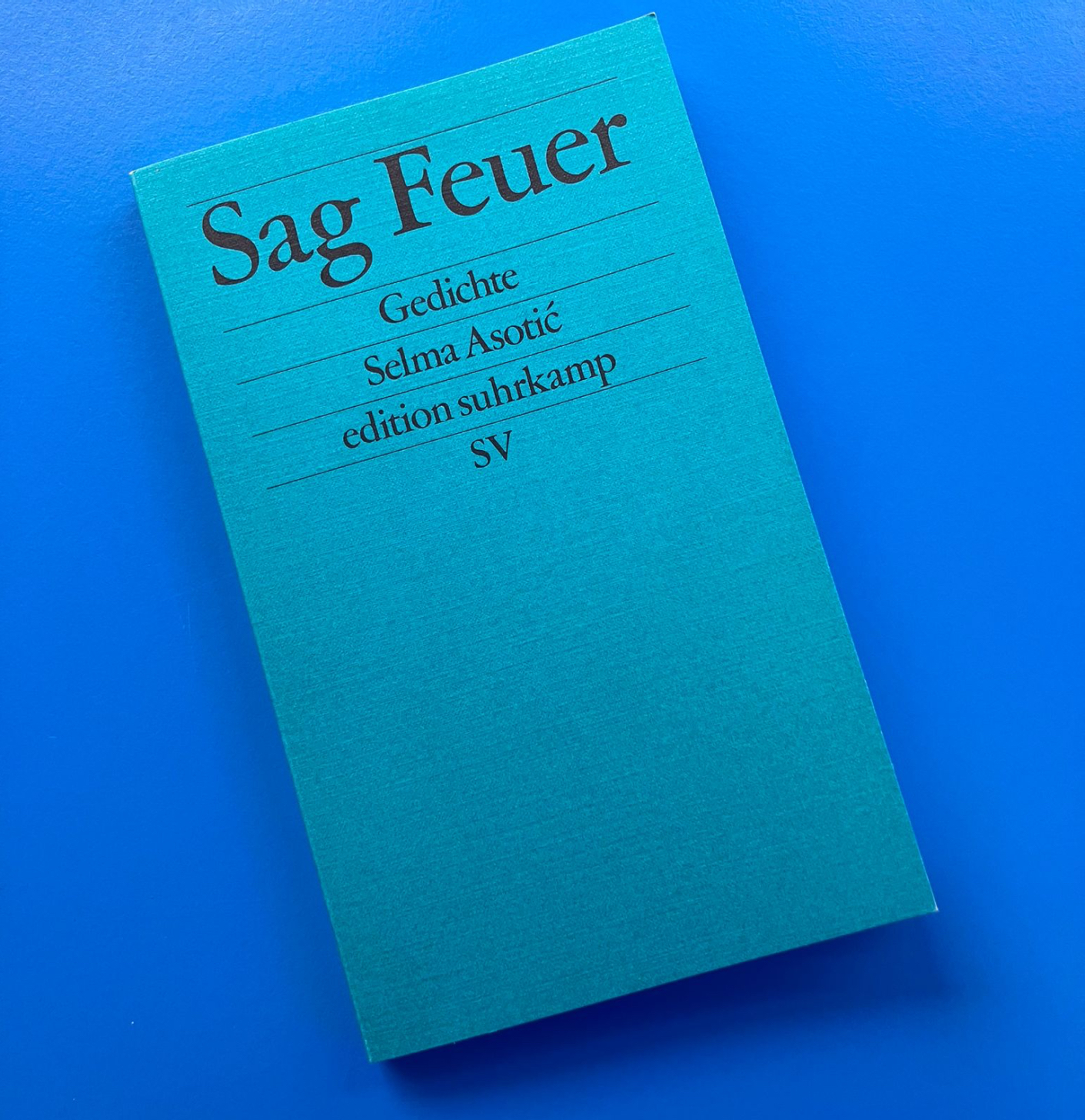von Matti Keller
In ihrem Gedicht I dwell in Possibility (Ich wohne in der Möglichkeit) fasst die US-amerikanische Dichterin Emily Dickinson die Lyrik als
A fairer House than Prose –
More numerous in Windows –
Superior for Doors –
Ein Nachhall dieser Verse findet sich in einem der 37 Texte von Selma Asotić, die unter dem Titel Sag Feuer am 17. November erstmals auf Deutsch bei Suhrkamp erscheinen. Das Gedicht Für die Frau, die meine Sprache lernt, nachdem ich ihre erlernt habe beginnt mit den Zeilen
Hier gibt es kein offenes Feld und kein Haus
aus Fenstern. Diese Sprache ist ein Zimmer, in dem du kniest,
in dem die Stimme Ruß von den Wänden kratzt,
Bis dir irgendwann der dunkle Efeu
im Hals hinaufrankt.
„Hier“, das ist die Sprache, in der das Gedicht geschrieben wurde, das Bosnische. Und „Hier“, das ist auch ein in bosnischer Sprache geschriebenes Gedicht, das sich kritisch mit den Bedingungen seiner eigenen Möglichkeit auseinandersetzt. Wo Emily Dickinson, anscheinend ganz heimisch in ihrer Muttersprache, von einem „Wohnen in der Möglichkeit“ schreiben konnte, ist die Sprache als Bedingung der Lyrik bei Asotić ein verrußtes Zimmer und das Sprechen eine dunkle, potenziell giftige Pflanze, die sich ihren Weg aus dem Bauch, durch die Speiseröhre in den Mund heraufbahnt – ein körperlicher, ein schmerzhafter Prozess von unheimlicher Schönheit.
Die Gedichte in Sag Feuer nehmen es aber nicht nur mit der Sprache auf, in der sie verfasst sind, sondern stellen sich anderen ideologischen Konstrukten genauso selbstbewusst entgegen: Der Nation etwa, dieser „Mutter sabbernder Söhne / mit ihrem haben wollen“ oder der Heimat, die, bevor sie Heimat wurde, doch nur „eine öde Pause zwischen Orten“ war. Und auch gegenüber ‚dem Westen‘ wissen sie sich zu behaupten, der immer wieder in neuer Verkleidung auftritt: Als Richter, der eine Unzuverlässige Zeugin darüber belehrt, dass ihr Glück und der schöne Garten, den sie hatte, bevor „sie die Stadt / in die Vergangenheit umsiedelten“ nicht relevant für den Gerichtsprozess sei. Oder als besorgter Intellektueller, „Kolumnist des New Yorker“, der Amerika vor der Balkanisierung retten will. Und als „Noa aus Oslo“, der in ein „Land der komplexen interethnischen Beziehungen“ gekommen ist, „um die Mechanismen der Gewalt zu erforschen“ – „nur noch ein paar Genozide, und er hat seine Professur.“
Selma Asotić beschleunigt auf 119 Seiten das Marx‘sche Versprechen der „Bourgeois-Epoche“: „Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht, und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen.“ Passend beschwören die Gedichte diverse Geister vergangener Revolutionen herauf, so etwa den jugoslawischen Volkshelden Matija Gubec, der 1573 einen Bauernaufstand anführte und dafür auf grausame Weise hingerichtet wurde oder die sowjetische Revolutionärin, Diplomatin und Autorin Alexandra Kollontai, die sich als Volkskommissarin für die Rechte der Frauen einsetzte und als einziges Mitglied des Zentralkomitees der KPdSU den stalinistischen Terror überlebte.
Der Titel ist also absolut ernst zu nehmen. Sag Feuer schont seine Leser:innen nicht mit vorsichtigen Reformvorschlägen. Im Gegenteil verwehrt es sich dezidiert gegen Beschwichtigungsversuche:
Statt Trost
sage ich Feuer. Statt Verzeih sage ich Feuer.
Statt Oktober sage ich das Licht
nimmt die Farbe von Schüssen an.
Die klare queer-feministische Haltung dieser Forderungen klingt bereits in der Auseinandersetzung mit der Muttersprache an, in der „bärtige Verben ihre Stöcke“ nur dann ruhen lassen, wenn frau sich totstellt. Als konstruktives Gegenprinzip zum Patriarchat wird die weibliche Genealogie, die Matrilinearität, in Stellung gebracht, die einen großen Raum in den Gedichten einnimmt: Immer wieder taucht Nana auf, die Großmutter, die hört wie „gelehrte Männermünder / Geschichten wiederkäuen / über Iblis [den Teufel] in der Frau.“ Und Niemand schreibt nach Hause ist eine Serie von vier Gedichten, in der das lyrische Niemand Briefe an Mama verfasst.
Es werden Reibungspunkte, Widersprüche und Konflikte zwischen den Generationen verhandelt in diesen Texten – und doch bestehen sie auf die Verbundenheit und den generationenübergreifenden gemeinsamen Kampf, der nicht immer gleich aussieht:
Eine beißt auf den Stein
in ihrem Mund, die nächste schluckt
die Zähne hinunter. Die Dritte spuckt aus.
Spricht.
Und hier, im Sprechen über weibliches und lesbisches Lieben und Begehren, im emanzipativen Sprechen über den weiblichen Körper findet Asotić dann doch zur Möglichkeit. Eine weitere Gedichtreihe ist es, die vomersten Mal in der einzigen Lesbenbar meiner Stadt, über das Coming Out hin zum Monolog fürs erste Date führt. Dieser beginnt mit den Versen:
Wie ein Streichholz bin ich gemacht aus
grenzenlosen Möglichkeiten, mit loderndem Haar
beule ich die Finsternis ein.
Wo Dickinson in der Möglichkeit wohnte, da brennt Asotić für sie.
Sag Feuer erscheint am heutigen 17. November 2025 in einer zweisprachigen Ausgabe bei Suhrkamp. Wer neugierig geworden ist und erstmal reinlesen möchte, findet den Text Monolog für ein zweites Date in englischer Sprache auf der Website der Jazz-Sängerin Jelena Kuljić, die ihn auf ihrer neuen Platte Fundamental Interactions vertont hat.