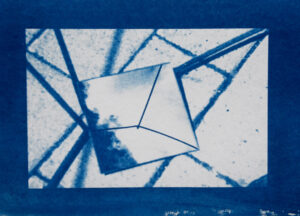von Clemens Heydenreich
Ein Gegenwartsphänomen, das seit Monaten den deutschen Buchhandel im wahrsten Wortsinne unsicher macht, ist die Graphic Novel. Der „Grafische Roman” kämpft sich frei aus seinem angestammten, eher öffentlichkeitsfernen Biotop — den Programmen spezieller Comicverlage nämlich — und hinein in die Neuerscheinungskataloge „klassischer” Literaturhäuser. Oder besser: Er wird freigekämpft. Der Comic-Roman Fun Home (2006) etwa, in dem die US-Autorin Alison Bechdel in zyklischen Suchbewegungen freilegt, wie das heimliche schwule Zweitleben des Vaters ihre Kindheit geprägt hat, ist laut Innentitel ein „Comic aus dem Hause Kiepenheuer & Witsch — und das ist gut so.” Ein launiges Kampfzitat, mit dem der Verlag vor einem als stirnrunzelnd gedachten Stammpublikum gleichsam die „Queerness” seiner kleinen Pioniertat feiert. Die Buchhändler indes wissen noch nicht so recht, wie umzugehen sei mit der neuartigen Ware. Mancher sortiert sie themenbezogen zwischen seine „normalen” Textliteratur-Titel ein, mancher ins Cartoon-Geschenkband-Regal zwischen Uli Stein und Joscha Sauer, und mancher wagt ein eigenes Graphic-Novel-Regalfach.
Fun Home ist ein Stück Literatur, aber zugleich ein Stück über die Literatur. Denn was die Erzählerin als Interpretamente ihres Tochter-Vater-Verhältnisses durchbuchstabiert, das sind die einst von beiden gelesenen Texte — von A wie Albee über H wie Homer bis W wie Wilde. Romane wie Fun Home zeigen, in welchem Sinn das Begriffspaar „Comic und Literatur” für ein Gegenwartsphänomen steht: Als ein Nebeneinander zweier Erzählmedien auf Augenhöhe, deren Zeichensprachen interferieren und deren künstlerische Hervorbringungen somit formal wie inhaltlich leicht aufeinander Bezug nehmen können.
Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen
Gleichwohl aber (und sonst hätten Kampfzitate auf Comic-Titeln auch keinen Sinn) weckt das Begriffspaar „Comic und Literatur” in Deutschland noch immer Assoziationen zur Vergangenheit — je nachdem, wen man fragt. Solche etwa, die vom Diskurs der 50er Jahre geprägt sind. Damals mussten Schüler ihre „Schmutz- und Schund”-Hefte auf dem Pausenhof zu Scheiterhaufen stapeln und erhielten im Gegenzug je „ein gutes Buch”. „Comic und Literatur” also als Dichotomie, die „Trivial”- versus „Hoch”-Literatur und Kitsch versus Kunst ausspielt. Ohne sie wäre eine zweite Assoziationsschicht nicht denkbar. Jene aus den 60er bis 70er Jahren, als die Paarung „Comic und Literatur” vor allem dort vorkam, wo Text-Autoren von Brinkmann bis Jelinek (die Malerei der Pop-Art lässt grüßen) im Motivpool der gezeichneten Trivialliteratur fischten, was sie gewiss nicht getan hätten, wenn es keinen Provokationswert gehabt hätte.
Summa summarum: In jenem diskursiven Spannungsfeld der Gegenwarts-Ästhetik, dessen Eckmarken „Comic und Literatur” heißen, regiert die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Wenn ich dies nun mit einer anachronistischen Lexikon-Definition Gero von Wilperts illustriere, dann freilich nicht, um damit Schlachten um die ästhetische Wertschätzbarkeit des Comic erneut zu schlagen, darüber höhnend, wie wenig Wilpert bewusst war, dass sie längst geschlagen sind. Sondern, um mit Wilpert über Lessing, Wilhelm Busch und andere Beispiele zu einem Zeichen vorzudringen, das die Bildsprache des Comic repräsentiert wie kein zweites: zur Sprechblase. „Fumetto”, Rauchwölkchen also, ist der metonymische Begriff des Italienischen für den Comic als solchen. Die Sprechblase steht, so meine These, als gültiges Meta-Symbol einerseits für die Erzählweise des Comic schlechthin (selbst wenn dieser im — gar nicht so seltenen — Einzelfall ohne Sprechblasen auskommt), andererseits für die divergenten ihm beigemessenen Wertungen „je nachdem, wen man fragt”. Und somit lässt sich an ihr zeigen, aus welchem Beunruhigungswert die grafische Literatur auch noch der Gegenwart viel von ihrem ästhetischen Potenzial bezieht.
Hieroglyphen und Zettelchen
Zum Lemma „Comic” also schreibt Gero von Wilpert in der 2001 (!) erschienenen 8. Auflage seines Sachwörterbuchs der Literatur:
„Die oft primitiv ausgeführten Zeichnungen überwiegen an Informationswert die gelegentlich eingeschobenen (…) Zwischentexte sowie den Dialog, der den Figuren in den für die C. typ. Sprechblasen (…) aus dem Munde quillt, und bestätigen den weitgehend unlit. Charakter der C. (…) Es ist bezeichnend für den Trivialcharakter der C., daß alle in Anspruch genommenen Vorläufer (außer den Bilderbogen) auf künstlerisch höherem Niveau stehen: der Teppich von Bayeux, ma. Miniaturen mit Spruchbändern, Hogarths Bilderfolgen (…).”
Zur Un-Literatur also macht den Comic laut Wilpert, dass er narrative „Informations”-Kompetenzen, die eigentlich Sache eines Textes wären, ans Bild abgibt. Damit greift Wilpert auf eine ästhetische Norm aus dem 18. Jahrhundert zurück, die eigentlich seit dem Beginn der Moderne um 1900 herum als überholt galt und schon gar in den 50er Jahren, als sich gleichwohl die erwähnte Jugendschutz-Debatte (deren Geist Wilperts „Comic”-Artikel seit seinem Ersteintrag konserviert) wieder an sie anlehnte. Gemeint ist die Norm, die Gotthold Ephraim Lessing 1766 in seiner Abhandlung „Laokoon: oder über die Grenzen der Malerei und Poesie” aufstellte: Poesie und Malerei erreichten ihre jeweils höchste Vollendung nur dann, wenn sie ihre je angestammten mimetischen Kompetenzfelder beackerten und nicht jenseits deren „Grenzen” im Revier der je anderen Kunst wilderten. Und zwar komme es der Textkunst zu, zeitlich Fortlaufendes, also Handlung, zu erzählen, so wie auch ihre eigenen Zeichen nur sequentiell im Zeitverlauf zu lesen seien. Die Bildkunst indes, deren Zeichen der Betrachter synoptisch wahrnehmen könne, sei für die Schilderung simultaner Zustände da.
Anschaulich macht Lessing dies, indem er vergleicht, wie bestimmte Texte und Bilder dieselben Gegenstände verhandeln, speziell Szenen aus dem Kampf um Troja. Zu jenen Szenen, in denen Homer die Unsichtbarkeit von Göttern oder göttlich entrückten Menschen beschreibt, indem er sie metaphorisch in „Wolken” oder „Nebel” hüllt, hatte der Kunsthistoriker Graf Caylus vorgeschlagen, die Malerei könne dies nachempfinden, indem sie die Entrückten gegenüber den Un-Entrückten durch eine Wolkenwand abtrenne. Lessing wehrt sich mit Nachdruck gegen dieses Mittel der Malerei, „uns zu verstehen zu geben, dass in ihren Kompositionen dieses oder jenes als unsichtbar betrachtet werden müsse”. Denn:
„Das heißt aus den Grenzen der Malerei herausgehen; denn diese Wolke ist hier eine wahre Hieroglyphe, ein bloßes symbolisches Zeichen, das den befreiten Held nicht unsichtbar macht, sondern den Betrachtern zuruft: ihr müsst ihn euch als unsichtbar vorstellen. Sie ist hier nichts besser, als die beschriebenen Zettelchen, die auf alten gotischen Gemälden den Personen aus dem Munde gehen.”
Was Lessing hier ablehnt, ist also nicht nur die Idee, die Malerei, von Hause aus der Mimesis des Sichtbaren verpflichtet, könne etwas darstellen, was kein Bild hergibt, nämlich etwas Unsichtbares. Was er zudem ablehnt, ist die vorgeschlagene Übernahme einer Sprach-Metapher ins Bild, die zugleich deren irrige Wörtlichnahme sei. Just das aber, was Lessing „Hieroglyphe” nennt, nennen wir heute eine „grafische Metapher”: ein Bildzeichen, das nicht mehr direkt auf jenes Signifikat verweist, mit dem es eine ikonische Ähnlichkeitsbeziehung hat. Im Fall der Wolke dient es dem Betrachter sogar als Meta-Signal, als Leseanweisung. Das gesprochene Wort wiederum, der gestaltlose Schall, überführt in die zeitliche Sequenz der Schrift, habe in der Malerei nichts zu suchen: „Zettelchen, die aus dem Munde gehen”, findet Lessing bereits an mittelalterlichen Spruchband-Gemälden ästhetisch ungehörig. Hierin zumindest urteilt Wilpert milder.
Zeitlupe und Zeitraffer zugleich
Die nach-Lessingschen Formen des Erzählens in Text und Bild sind uns heutzutage selbstverständlich geläufig: Comic und Film. Ihre technischen Voraussetzungen kamen zwischen 1850 und 1900 auf, zur selben Zeit also, als die von der idealistischen Ästhetik des „Wahren, Schönen, Guten” getragenen Mimesis-Modi der Literatur und Malerei fragwürdig wurden und die erkenntnistheoretische Sprachkrise heraufdämmerte. Grafische Metaphorik, die unter solchen Voraussetzungen schnell ins Grundarsenal des Comics und des Films Eingang fand, ist uns heute ebenso geläufig. Selbst wenn sie wie in David Mazzucchellis Paul-Auster-Adaption „Stadt aus Glas” als Metaphorik gleitender Übergänge daherkommt, irritiert sie nur unerfahrene Comicleser.
Nicht jeder indes (siehe Wilpert) hat seinen Frieden gemacht mit jener grafischen Metapher, die 1896, also just 130 Jahre nach dem „Laokoon”, im US-Comic-Strip „Yellow Kid” ihren Siegeszug antrat und den Schall gesprochener Rede ins Bild integriert, indem sie ihn in ein Rauchwölkchen kleidet: die Sprechblase. So wie im von Lessing gewählten Beispiel stellt die Wolke (genauer: die gezeichnete Linie, die die Silhouette der Wolke beschreibt) ein nicht-mimetisches Signal an den Leser dar. Als nur für diesen sichtbares Bild verkörpert die Wolke, was die handelnden Figuren selbst nicht sehen, sondern nur hören können — ihre Rede -, und grenzt sie ab vom Raum dessen, was für sie und den Leser sichtbar ist.
Der erste große deutsche Erzähler, der gewichtige Teile (oft sogar die Hauptlast) des Narrationsvorgangs dem Bild überantwortete, war Wilhelm Busch. Sprechblasen verwendete er in seinen Bildergeschichten, die zwischen 1859 und 1884 entstanden, zwar fast nicht. Und doch ist an einer bestimmten Vier-Bilder-Sequenz aus Buschs galliger Legenden-Parodie „Der Hl. Antonius von Padua” (1870) bereits in nuce zu zeigen, was die spezifische (Rezeptions-)Ästhetik des modernen Sprechblasencomics ausmacht, die, an der des „reinen Textes” gemessen, defizitär oder überkomplex ist — je nachdem, wen man fragt. Tragende Rollen in dieser Sequenz spielen Schall, Rauch und eine Wolke.
Wir sehen Antonius (links) und seinen Mitreisenden Doktor Allopecius (rechts, mit Schirm). Dass der zugehörige Text hier leider nicht mit reproduziert werden kann, ermöglicht immerhin einen ungebrochenen Blick auf die Bildsequenz, der verdeutlicht, dass nur sehr wenig Zeit zwischen den Szenen vergeht. In „enger Bildfolge” sehen wir erstens beide Wanderer im Regen, zweitens, wie die Wolke den rechten Mann auf höheres Kommando hin per Blitz niederstreckt, drittens, wie Allopecius verkohlt, und viertens, wie die Wolke den Auftrag, Antonius ein gleiches anzutun, nicht ausführen kann — mit Verweis auf die Jungfrau Maria, die den frommen Mann beschützt.
Anders als ein erster Gesamtblick auf alle vier Bilder suggeriert, gliedern diese die verlaufende Zeit keineswegs gleichmäßig in vier Momentaufnahmen. Vielmehr halten zwar das erste und dritte Bild jeweils „schnappschussartig” einen Augenblick fest, doch im zweiten und vierten spielt sich ein Binnen-Zeitverlauf von jeweils mehreren Sekunden ab. Zweimal erhält die Wolke zunächst „von oben” ein Kommando, zweimal reagiert sie darauf, jeweils im selben Bild. Beide Verläufe von Impuls und Reaktion gestaltet Busch mit unorthodoxen Mitteln. Die Kommandos fahren als Schriftzeichen via Schalllinien ins Zentrum der Wolke. Diese wiederum verformt sich anthropomorph und prägt im ersten Fall eine linke Hand aus, mit der sie wie der alte Zeus — Achtung: Grafisierte sprachliche Metapher! — „einen Blitz schleudert”, im zweiten Fall eine rechte, mit der sie, gleichsam über die Schulter hinweg, auf die Madonna verweist.
Die vier Bilder also formieren — bereits rein als Bilder gelesen — einen alternierenden Rhythmus aus zwei Schnappschüssen und zwei Binnenhandlungen. Hinzu kommen dann aber noch 18 Zeilen gereimten Textes, der die Gesamtsequenz parallel erzählt — manche Informationen auslassend, manche hinzufügend — und, laut gelesen, gut 45 Sekunden dauert. Keine sehr lange Erzählzeit also, aber gewiss länger, als man den erzählten Zeitverlauf rein anhand der Bildeindrücke taxiert hätte. Kurz und gut: Eine in sich von rhythmischer Spannung geprägte Bilderreihe erzählt das Geschehen raffend, ein komplementärer Text erzählt dasselbe zeitdehnend. In beiden Zeichenhälften herrscht also, mit Genette gesprochen, je eine Anisochronie, und zueinander verhalten beide sich gegenläufig. Dem Text-Bild-Verhältnis ist somit eine Unruhe inhärent, die hier funktional erklärbar ist (etwa wirkt der freie Knittelvers, den Busch in diesem Kapitel gebraucht, zeilenweise so enervierend umständlich, dass er die ungerührte Kontemplation des Antonius schön untermalt). Doch zeigt sich an ihr zugleich allgemeingültig, wodurch die Lektüre eines Comics potenziell zu einem komplexeren Unterfangen wird, als es die eines „reinen” Textes ist.
Lektüre im Reißverschlussverfahren
Dass es dem Comic an keinem jener Mittel gebricht, mit denen Textliteratur erzählerische Komplexität erzeugt, braucht hier nicht raumgreifend erläutert zu werden. Narrativ ausgerichtete Comics können mit Leitmotivik arbeiten, mit Mehrsträngigkeit, Polyphonie, Anachronien (also Vor- und Rückblenden), diegetischen Verschachtelungen, mit interner, externer oder Nullfokalisierung durch Erzählinstanzen, die gerne auch mal unzuverlässige sein dürfen. (Eine eigene Betrachtung wert wäre allerdings, ob der „Literarizitäts”-Begriff für den Comic auch jenseits narrativer Darstellungsformen trägt. Lassen sich bestimmte Comics auch als „lyrisch” bezeichnen — etwa die eher kurzen, narrationsarmen, dafür sehr atmosphärischen und chiffrendurchsetzten Comics aus der grafikbetonten „Hamburger Schule” um Atak und Anke Feuchtenberger?). Was hier betont werden soll, ist die Rezeptionsseite, also der spezielle Lektüreverlauf der Bildergeschichte.
Wer erzählende Textliteratur liest, nimmt deren Zeichen streng linear auf. Zwar hat er theoretisch alle Freiheiten innezuhalten, Zeilen wiederholt zu lesen, vor- und zurückzublättern oder ganze Seiten zu überspringen. Doch wird er unterm Strich, selbst wenn er alle Leserlenkungsstrategien des Textes durchaus erkennt, willig der schieren Zeichenanordnung nachgeben, die ihn linear vorwärtstreibt. Und keinesfalls wird er größere Teile des Erzählinhalts entschlüsseln, indem er einen Simultanblick auf die Seite wirft.
Wer indes grafische Literatur liest, wechselt unentwegt zwischen simultanen und sukzessiven Sinneseindrücken, und das gleichsam im Reißverschlussverfahren. Der jeweils erste Blick ist ein synoptischer: Beim Aufblättern jeder neuen Doppelseite wirft der Leser unwillkürlich zuerst einen Blick auf deren grafische Architektur und dieser teilt ihm (zumindest in groben Zügen) mit, ob sich in der allernächsten Lesezukunft etwas an der Raumkulisse oder Figurenkonstellation ändern wird, ob Dialog oder Handlung dominieren und wie viel erzählte Zeit verstreichen wird. Schon dies macht die Hermeneutik des Comic-Leseaktes zu einer speziellen. Zwar lebt sie wie die Hermeneutik der klassischen Textlektüre von der Differenz zwischen Lesererwartung und deren Einlösung oder Nicht-Einlösung, doch ergibt sich jene Erwartung nicht allein aus dem Abgleich, den der Leser in stetem Fluss zwischen neu gewonnenen Daten und erinnerten vollzogen hat, sondern zudem durch ein gewisses Quantum an gesichertem Vor-Wissen. Für die Narration schränkt dies einerseits gewisse Möglichkeiten ein. So müssen etwa Überraschungsmomente, die sehr handlungs‑, also bildbezogen sind, räumlich so platziert werden, dass sich ihr „Zündungsmoment” im Narrationsverlauf möglichst mit jenem im Lektüreverlauf deckt, also mit dem Aufblättern einer neuen Doppelseite. Für den Leser indes bedeutet es den Genuss, sich ansatzweise „zukunftsmächtig” zu fühlen, eine Form der Ahnung bevorstehender Dinge zu haben, wie sie einem Text- oder Filmrezipienten nicht vergönnt ist. Andererseits erfasst sein Synchronblick eben nicht alles (der Zeitverlauf bei Busch hat es gezeigt), und dies wiederum schafft der Narration ganz eigene Spielräume, die Vorahnung so zu unterlaufen, dass es eben doch zu Überraschungen erst beim Lesen einzelner Panels kommt oder gar erst beim Akt des nächsten Umblätterns: Legendär ist der Loch-im-Papier-Kunstgriff in Marc-Antoine Mathieus Erzählung „Der Ursprung”.
Mit den Erkenntnissen oder Ahnungen der ersten Synchronbetrachtung gewappnet, steigt der Leser nun ins Einzelpanel ein. Er liest den Text — so vorhanden — sequentiell und betrachtet das Bild simultan. Erst im Abgleich beider Zeichensysteme erschließt sich ihm das Weitere. Weist das Bild einen Zeitverlauf mit zu „lesender” Binnenhandlung auf? Deckt sich seine innere Zeitstruktur mit der des Textes? Wenn nein, gibt es in der Verwerfung etwa zwischen „lang” andauernder Sprechblasenrede und „kurzem” Bild-Zeitausschnitt eine erzählerische Funktion? Ferner: Was zeigt das Bild, was zeigt es nicht? Dass er selbst es ist, der optische Unbestimmtheitsstellen zu füllen hat, bleibt dem Leser etwa einer Folge kleinteiliger, mit engen Ausschnitten arbeitender und womöglich auch noch hart die Perspektive wechselnder Comic-Bilder stets bewusst, während der Rezipient eines Textes oder Films ähnliche Konstruktionsleistungen meist weniger bewusst vornimmt.
Und dann: Was passiert zwischen den Bildern? Joe Sacco zeigt in einem Panel seines Bosnienkrieg-Reportagecomics Safe Area Gorazde, wie ein Soldat ein Kind über eine Brückenbrüstung hält. Im nächsten Panel sind die Hände des Soldaten leer. Was ist passiert? Ab jenem Moment, in welchem der Leser es schaudernd zu wissen glaubt, hat er seine eigene Unschuld verloren, denn so recht eigentlich ist er es selbst und nicht der Soldat, der die Gräueltat begangen hat. Gleichsam zwischen den Zeilen (hier: zwischen den Panels) liefert Sacco so die Erkenntnis mit, dass im Krieg niemand unbeteiligt bleiben kann, auch der Beobachter nicht.
Der von Scott McCloud so getaufte „Rinnstein”, die Leerstelle zwischen den Panels, ist die für den Comic sowohl typischste als auch unvermeidlichste Herausforderung an das Konstruktionsvermögen des Lesers. Je nach kontextueller Funktion kann sie leicht oder schwer ausfallen: Leicht etwa, wenn benachbarte Bilder dieselben Orte und Figuren in gleichmäßig segmentiertem Zeitverlauf zeigen; schwerer, wenn sie keinen Zeitverlauf abbilden, sondern divergente Orte oder Gegenstände zum selben Zeitpunkt. Oder wenn sie umgekehrt — als „split panels” — mehrere perspektivisch zusammenhängende Segmente desselben Ortes präsentieren, wobei jedoch die eingezogenen Rinnsteine andeuten, dass sie verschiedene Zeitpunkte zeigen wie auf dieser Seite aus Art Spiegelmans Maus:
Der synoptische Blick sieht Vater Spiegelman panelübergreifend im Ganzen auf dem Trimm-Dich-Rad sitzen, bevor dann die sequentielle Lektüre zum jeweils narrativ passenden Zeitpunkt erst an seinem Kopf vorbeikommt, mit dem er dem Sohn zuhört, dann seine sich verkrampfenden Hände und den Arm mit der KZ-Nummer in den Blickwinkel rückt und schließlich seinen Fuß, der den Erinnerungsgang „lostritt” und das Rad antreibt, an dessen Stelle ein rundes Panel in die Binnenerzählung überleitet: Erzählende Erinnerung also als die obsessive, repetitive Handlung eines Mannes, den das Erinnerte innerlich gebrochen hat und äußerlich auf dem Fleck treten lässt.
An diesem Bildbeispiel wird überdeutlich, dass die wechselnde Abfolge synchroner und diachroner Blickakte, mit denen der Leser sich vom Ganzen ins Detail und von Panel zu Panel bewegt, allenfalls „in summa”, nämlich rückwirkend vom Zeitpunkt des nächsten Umblättern her gesehen, eine lineare ist. In ihrem Verlauf jedoch ist ein asynchrones Voraus- und Zurückschweifen des Blicks oft ganz unvermeidlich, ein Schweifen, wie es die Lektüre „reinen” Textes nicht direkt nahe legt, sondern allenfalls gestattet, und wie es die Rezeption eines Films geradezu unterbindet. Jener sehr starken interaktiven Leistung wegen, die der Comic-Leser zumindest potenziell, je nach Anspruch der Erzählung, zu erbringen hat, rechnete Marshall McLuhan den Comic in seiner Klassifikation „heißer” versus „kalter” Medien zu den letzteren: Zu jenen also, die ihren Rezipienten zur erfolgreichen Sinnstiftung „high involvement” abverlangen, eine starke Eigenbeteiligung, statt ihnen mit dichter, detaillierter Information ein scheinbar lückenlos vorgefertigtes Sinnangebot zu machen.
Was sich also die Literatur, die Malerei und der Film des 20. Jahrhunderts im Zeichen der sprachphilosophischen und quantenphysikalischen Erkenntniskrise erst erarbeiten mussten, das war die hybride Zeichensprache des Comic bereits ab ovo und von Haus aus: Eine Präsentationsform, die das Bewusstsein der Relativität von „Subjekt” und „Wirklichkeit”, von Zeit und Raum, von Wahrnehmbarem und Nicht-Wahrnehmbarem sowie vom Einfluss des Wahrnehmenden auf das Wahrgenommene stets integrierte in das, was bei alledem an künstlerischer Mimesis noch möglich und vertretbar blieb.
Der untote Chronotopos
Wie der Comic das leistet, das zeigt — pars pro toto — die Sprechblase. Sie ist ein Zeichen, das Schall und Rauch, Text und Bild, Raum und Zeit spannungsreich in eins setzt und dessen Bildseite zugleich auf verschiedenen Ebenen Verweiskraft beibehält.
Eine Wolke verändert ihre Gestalt unablässig. In jedem Moment, in dem ein sprachliches oder bildliches Bild sie einfängt, sieht sie anders aus als in jedem nicht-eingefangenen Moment davor und danach. Im ästhetischen Zusammenhang bildet sie ein Raum-Phänomen, in das eine zeitliche Tiefendimension über den Moment hinaus eingeschrieben ist, oder, um an dieser Stelle einen Begriff zu gebrauchen, den Michail Bachtin in freier Anlehnung an Einsteins Raum-Zeit-Erkenntnisse prägte, einen Chronotopos. Als solcher integriert etwa die vielleicht prominenteste Wolke der modernen deutschen Lyrik in Brechts „Erinnerung an die Marie A.” eine mystische Dialektik aus kurzem Glücksmoment und unendlicher Erinnerung. Jene Wolke, die im Comic nicht mehr aktiv als erzählende Trope gebraucht wird, sondern qua Lesekonvention ein Teil der grammatischen Meta-Ebene geworden ist, ist also nicht nur eine tote Metapher, sondern auch ein toter Chronotopos. Genau genommen aber ein untoter, denn die in ihm konservierte Spannung zwischen Zeit und Raum, zwischen dem eingefrorenen Umriss-Moment und all den abweichenden, nicht-eingefrorenen Momenten davor und danach, wird wieder augenfällig dadurch, dass der statische Wolkenumriss mit dynamisch zu lesenden Textzeichen gefüllt wird, dass er dem (oft) statischen Bildraum des Panels einen Zeitverlauf einschreibt.
Auch der reinen Metaphernfunktion der konventionalisierten Wolke kann der Comic-Autor übrigens allemal phasenweise Leben einhauchen. Dies geschieht etwa, wenn in Streit um Asterix die Sprechwolken zu grün gefärbten Giftwolken werden und somit auf „vergiftete Rede” verweisen, oder wenn Carl Barks seinem Antihelden Donald Duck in depressiver Stimmung eine schwarz schraffierte Denkblase beigibt, aus der tatsächlich Tropfen fallen.
Innerhalb des Comic-Erzähldiskurses geschieht eine solche Re-Metaphorisierung nur fallweise, sonst wäre ihr (hier: komischer) Effekt nicht stark genug. Außerhalb des Erzähldiskurses aber, im Reden über den Comic als solchen, nehmen auch und gerade Skeptiker die Text-Wolke als Pars-pro-toto-Repräsentantin des Mediums schlechthin: Und ihnen höchst lebendig vor Augen stehen die Konnotate des Realvorbildes (im deutschen Sprachgebrauch besser: beider Realvorbilder, der Wolke wie der Blase) besonders dann, wenn es darum geht, den scheinbar abschätzigen, nachlässigen Umgang des Comics mit seinem Textanteil zu beklagen.
Genau genommen war es nicht der Comic als solcher, dem in den 50er Jahren die Autodafés auf deutschen Schulhöfen galten. Es war der Sprechblasencomic amerikanischer Prägung, an den deutsche Erwachsene nicht gewöhnt waren — anders als an die Comics eines Wilhelm Busch, in denen meist bildexterne Erzählinstanzen walten, oder eines E.O. Plauen, der ganz ohne Text auskommt. Hinter der Abwehrhaltung gegen das „neue” Medium, das die Kinder- und Jugendkultur zu prägen und so die geistigen Lebenswelten von Alt und Jung zu trennen drohte, stand aber gewiss mehr als nur der allfällige kulturnationalistische Widerwille gegen jedweden Fremdimport. Das „ganz Andere” und eigentliche Skandalon, das man speziell in der importierten Variante eines eigentlich nicht unvertrauten Mediums sah, war die Sprechblase, denn erst sie implementierte, zum einen, ganz augenfällig einen Zeitverlauf ins Bild und dies zum anderen dadurch, dass sie Text enthielt und ihn dem Bild ein‑, also scheinbar unterordnete. Ersteres schien der Sehkonvention wahrnehmungswidrig, letzteres einer logozentrisch geprägten Lese-Ästhetik sittenwidrig. Das pädagogisch verordnete Tauschgeschäft „Gutes Buch versus Schmutz- und Schundhefte” spricht, sozusagen, Bände: Als ideale Norm des Erzählens auf Papier galt die Zeichensprache des Textes, dem sich gegebenenfalls beigefügte Bilder in illustrativer Funktion nachzuordnen hatten. Nur aus dieser unterschwellig noch immer an Lessing orientierten Norm heraus erklärt sich die Haltung, ein Erzählen aus „Text plus Bild” sei notwendig eines aus „Text minus X”, ein defizitäres Erzählen, das einen überwiegenden Anteil seiner Letternsprache durch das unvollkommene Substitut des Bildes ersetze.
Wer aber im Comic nicht etwa Bild und Text einander potenzialreich ergänzen sah, sondern das erstere den letzteren abwerten, dem muss vollends als Provokation erschienen sein, was er mangels Lesepraxis nicht als tote, sondern als sehr lebendige Bildmetapher nehmen musste: die Sprechblase. Wolken sind leicht, und Blasen sind hohl; was also in ihnen dahergeschwebt kommt, muss entweder sehr kleinteilig sein oder leicht von Gewicht. Ein Text in Wolken lässt sich einfach und unbesehen diskreditieren: als flüchtig, ungenau, inhaltsarm. Und als fragmentarisch — als Produkt der Verknappung nämlich, jedoch nicht jener estimierten Verknappung, mit der etwa ein kurzes Gedicht zelebriert, wie viel freien Umgebungsraum es zu nutzen nicht nötig hat, sondern einer Verknappung aus schierer Platznot, die sie daran hindert, zu leisten, was eine „unbegrenzte” Sprache zu leisten vermöchte. Just andersherum, aber im selben polemischen Geiste wird die Sprechblase bis heute auch als Sprachmetapher gebraucht. Wenn eine Zeitungsglosse einem Politiker unterstellt, er rede in „Sprechblasen”, dann unterstellt sie dessen Rede eben gerade nicht pragmatische Kürze, sondern inhaltliche Wolkigkeit in Tateinheit mit filibustrierender, „aufgeblasener” Länge.
Der gekränkte Textglaube
Wohlgemerkt: Was westdeutsche Kioske der 50er Jahre an Comics feilboten, das war in der Tat oft leicht und mit ästhetischem Recht zu diskreditieren. Davon, das oben beschriebene Potenzial des Comics auch tatsächlich zu nutzen, waren die zeittypischen Genre-Piccolos um Dschungel- oder Westernhelden so weit entfernt wie Konsalik von Kafka. Gleichwohl dürfte auch das Materialkorpus, das McLuhan zur Verfügung hatte und das ihm sehr wohl genügte, um anhand seiner das Potenzial des Mediums aufzuzeigen, kaum von höherer Qualität gewesen sein. Und so scheint es nicht abwegig, zu unterstellen, dass die deutschen Kulturkritiker am Comic just dasselbe bemerkten, aber eben mit Unbehagen quittierten, was McLuhan als Herausforderung zum „high involvement” belobigte: die Unübersichtlichkeit einer hybriden Zeichensprache. Ein Unbehagen, das viele noch heute teilen. Ihm entspricht komplementär die Sehnsucht nach einem erzählten Sinn, der in scheinbar einheitlichen Zeichensystemen daherkommt, die mit ihrer geordnet und geschlossen wirkenden Ästhetik dafür zu bürgen scheinen, dass auch ihr Inhalt Orientierung bietet. Das konstante, verlässliche Gleiten des Auges über einen Text, sein Schweifen über ein Gemälde, sein Ruhen auf der Kinoleinwand sind Rezeptionsweisen, die eine Art physischen Grundvertrauens in die Sinnhaftigkeit des Erzählten selbst dann noch gewähren, wenn dessen Inhalt irritiert oder Fragen aufwirft. Am Comic irritierte die deutschen Erwachsenen der 50er Jahre allem Inhalt vorgängig bereits die Form (was im übrigen der Hauptunterschied gegenüber der US-amerikanischen Schmutz-und-Schund-Debatte ist, die zeitgleich ablief und sich zuvörderst um Inhalte drehte). Und die Literaturpädagogen irritierte sie umso mehr, als in ihren germanistischen Seminaren aus dem Ideologie-Trauma der Nach-NS-Zeit eine „werkimmanente” Lektürepraxis erwachsen war, die den Text als intimen Ort eines direkten, mystisch-meditativen Dialogs zwischen Leser und Autor geradezu heiligte.
Letzte indirekte Ausläufer der Schmutz-und-Schund-Debatte prägen den deutschen Comic-Diskurs noch immer. Dass sie eine Jugendschutz-Debatte war, blieb im kollektiven Gedächtnis in Form einer unhinterfragten Koppelung des Mediums Comic an eine ganz bestimmte Zielgruppe haften, was dazu führte, dass die langjährig sich ausprägenden Trends der italienischen, frankobelgischen und amerikanischen Comic-Szene hin zum „Erwachsenencomic” in die deutschen Verlagsprogramme erst ab den Achtziger Jahren, in Lehrpläne und Feuilletons erst ab den Neunzigern vordrangen.
Die „Graphic-Novel”-Verlagsstrategen der Gegenwart übrigens versuchen noch immer, skeptischere Teile des Publikums bei einem Rest jener logozentristischen Haltung alter Zeiten abzuholen. Nämlich bei der Ansicht, das höchstzuschätzende Trägermedium des Erzählerischen sei Papier in handlichem Zuschnitt und zwischen harten Deckeln. „Das gute Buch” lässt grüßen. Inhaltlich aber ist eine allgemein steigende Wertschätzung grafischen Erzählens allmählich zu spüren. Ob Zufall oder Absicht: Auffallend ist, dass just jene klassischen Buchverlage, die erst neuerdings auch „Graphic Novels” herausbringen, allein in dieser kurzen Zeit unter dem (für sie) neuen Rubrum deutlich mehr Biografien, Autobiografien und Reiseberichte subsumiert haben, als sie es jemals zuvor unter dem Rubrum „Roman” getan hätten. Gattungen also, deren rein textuelle Hervorbringungen auch nach dem „Linguistic Turn” noch so lange die landläufige Vorstellung anhing, sie „dokumentierten Wirklichkeit”, dass selbst die Literaturwissenschaft sie erst seit Neuerem als narrativ wahrnimmt und auf Stilisierungs- und Fiktionalisierungsstrategien hin abklopft. Auffallend, aber vielleicht nicht verwunderlich: Offenbar macht die spezielle Hermeneutik des Comiclesens den Fiktionscharakter jedweden Erzählinhalts augenfällig — was vielleicht (man wird ja noch träumen dürfen) bei Menschen, die sich an sie gewöhnen, rückwirkend zu einer aufgeklärteren Rezeption reiner Textliteratur beiträgt.
Bleibt die Frage, ob man den Begriff „Graphic Novel”, „Grafischer Roman”, denn nun eigentlich partout braucht. Die Antwort auf sie kann wiederum nur lauten: Kommt ganz drauf an, wen man fragt. „Ja” dürfte der unakademische Comic-Nerd sagen, denn für ihn grenzt dieser Begriff assoziativ eine Teilsphäre des Comic-Universums ein, in der sich zwischen Buchdeckeln publizierte, tendenziell umfangreiche und abgeschlossene Geschichten um nicht-seriell angelegte Figuren drehen; Geschichten, die den „klassischen” Genre-Teilwelten populärer Seriencomics (etwa denen der Fantasy oder Superhelden) nicht verpflichtet sind oder sie nur aufgreifen, um sie mit erklärtem Kunstwillen aufzuwerten. „Nein” wird der Literaturwissenschaftler sagen, der zwar sowohl die Ausgrenzungskraft des Begriffs gegenüber den erwähnten Comic-Umwelten sieht als auch jene gegenüber der nicht-grafischen Romanliteratur, der aber darüber hinaus gern einen eingrenzenden, inhaltliche Gemeinsamkeiten integrierenden Aspekt sähe. Der Verleger hingegen wird allemal „ja” sagen — und zwar mit jenem sprichwörtlichen, ganz eigenen Recht, das ihm der (Verkaufs-)Erfolg gibt. Wenn’s denn dazu führt, dass ein noch breiteres Publikum als bislang die interessanten Möglichkeiten grafischer Literatur entdeckt, dann sind Namen letzten Endes Schall und Rauch.
Literatur:
• Alison Bechdel: Fun Home. Eine Familie von Gezeichneten. Köln 2007.
• Wilhelm Busch: Die Bildergeschichten. Historisch-kritische Gesamtausgabe in drei Bänden. Hg. von Hans Ries. 2.,
überarbeitete Auflage. Hannover 2007
• Dietrich Grünewald: Comics. (=Grundlagen der Medienkommunikation Bd. 8.) Tübingen 2000.
• Gotthold Ephraim Lessing: Laokoon: oder über die Grenzen der Malerei und Poesie. In: ders.: Werke und Briefe. Bd. 4:
1758–1759, hg. von Gunter E. Grimm. Frankfurt/M. 1997, S. 345–411.
• Nina Mahrt: Tempo machen. Überlegungen zu Zeit und Rhythmus im Comic. In: Comic!-Jahrbuch 2006. Stuttgart 2005,
S. 32–41.
• Marc-Antoine Mathieu: Der Ursprung. Hamburg 1992.
• Paul Karazik / David Mazzucchelli: Paul Auster’s Stadt aus Glas. Reinbek 2000.
• Scott McCloud: Comics richtig lesen. Hamburg 1994 u.ö.
• Stephan Packard: Anatomie des Comics. Psychosemiotische Medienanalyse. Göttingen 2006.
• Andreas Platthaus: Im Comic vereint. Eine Geschichte der Bildgeschichte. Frankfurt/M. 2000.
• Eckart Sackmann: Comics sind nicht nur komisch. Zur Benennung und Definition. In: ders. (Hg.): Deutsche Comicforschung
2008. Hildesheim 2007, S. 7–16.
• Art Spiegelman: Maus. Die Geschichte eines Überlebenden. Reinbek 1989 u.ö.
• Gottfried Willems: Abschied vom Wahren — Schönen — Guten. Wilhelm Busch und die Anfänge der ästhetischen Moderne.
Heidelberg 1998.
•´Gero von Wilpert: Sachwörterbuch der Literatur. 8., verbesserte und erweiterte Auflage. Stuttgart 2001.