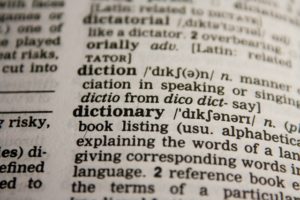Interview mit Christoph Peters
von Sandra Baier und Hannes Müller
Auf seiner Reise an der „deutsch-japanischen Grenze“ bewegt sich Christoph Peters Roman „Herr Yamashiro bevorzugt Kartoffeln“ souverän zwischen den Kulturen. Die vermeintlichen Grenzen stellen dabei keine Hindernisse dar, sondern werden stetig verschoben und übertreten. Lassen sich dann darin Spuren von Transkulturalität erkennen? Oder was passiert mit diesen Zonen? Christoph Peters geht im Interview mit SCHAU INS BLAU diesen Fragen nach und spricht über seine Liebe zu Japan, den Prozess des Schreibens und Transkulturalität auf der Subjekt- und Objektebene.
SCHAU INS BLAU: Sie haben zahlreiche Bücher mit japanischen Einflüssen geschrieben und thematisieren die japanische Kultur explizit. Man muss sich nicht weit aus dem Fenster lehnen, um Ihnen ein Faible für Japan zu unterstellen. Woher kommt Ihr gesteigertes Interesse für Japan?
CHRISTOPH PETERS: Das reicht sehr weit zurück. In dem katholischen Internat, wo ich meine Gymnasialzeit verbracht habe, gab es einen Kunstlehrer, der gleichzeitig ein berühmter Kunstsammler ist, Franz-Joseph van der Grinten. Der zeigte mir irgendwann japanische Holzschnitte, Kalligraphien und diese sehr reduzierten, vom Zen-Buddhismus geprägten Tuschemalereien von Landschaften und Tieren, weil er dachte, das könnte mich interessieren. Vor allem die Kalligraphien und Tuschemalereien sehen ja sehr modern aus, selbst wenn sie 400 Jahre alt sind. Diese Bilder haben mich damals richtiggehend angesprungen. Dann bekam ich von ihm Eugen Herrigels „Zen in der Kunst des Bogenschießens“ in die Hand gedrückt, wo diese im Zen gegründete – ich nenne das: „Spiritualität der künstlerischen Prozesse“ – in ihrer Geistigkeit und Praxis erläutert wird. Damals habe ich selbst sehr viel gezeichnet und machte dabei solche sonderbaren Erfahrungen von „Im-Tun-eins mit dem Augenblick“-Sein.
Daneben stieß ich über einen Freund, der sich da schon besser auskannte, auf die Samurai-Filme von Kurosawa und war fasziniert von dessen Bildsprache, aber eben auch von dieser dunklen Seite des Zen-Geistes. Mit denselben spirituellen Übungen, mit denen man aus einer Linie ein Pferd in seiner ganzen Substanz aufs Papier tuscht, wird man auch zum perfekten Schwertkämpfer.
SCHAU INS BLAU: Wie schlägt sich das Interesse für die japanische Kultur in Ihrem Alltag nieder?
CHRISTOPH PETERS: Als erstes gibt es morgens japanischen grünen Tee. Mein Arbeitstag beginnt dann gegen halb neun damit, dass ich eine halbe Stunde bei verschiedenen Online-Händlern alles anschaue, was an japanischen Keramiken neu am Markt ist. Die japanischen Händler fotografieren ihre Objekte sehr gut und normalerweise mindestens aus 8–10 verschiedenen Perspektiven, so dass ich im Laufe der 9 Jahre, die ich das jetzt mache, wahnsinnig viele Dinge unterschiedlichster Qualität angeschaut habe. Manchmal kaufe ich auch etwas, je nachdem. Wenn noch Zeit ist, sehe ich noch die Rollbilder an. Wenn der Text, an dem ich gerade arbeite, mit Japan zu tun hat, schaue ich fast nur japanische Filme, lese japanische Romane, Mangas, Sachbücher über Zen oder Yakuza etc. Den ganzen Tag über gibt es eigentlich japanischen Tee und nach Möglichkeit versuche ich einmal am Tag etwa eine Stunde lang Teezeremonie zu üben. Daneben koche ich oft japanisches Essen.
SCHAU INS BLAU: Welche Rolle spielt für Sie die Teezeremonie?
CHRISTOPH PETERS: Wie gesagt: Ich versuche, einmal am Tag Teezeremonie zu üben. Die Faszination dafür reicht auch bis in die Schulzeit zurück. Ich glaube bei „Shogun“, das war damals diese Fernseh-Serie mit Richard Chamberlain, habe ich zum ersten Mal eine Teezeremonie gesehen, dann in den beiden Filmen über Sen no Rikyu, von Hiroshi Teshigahara und Kei Kumai, die beide 1989 in die Kinos kamen. Sowohl die Schönheit und Strenge der Form haben mich sehr angezogen, aber auch diese eigenartige Mischung aus Performance und Kunstbetrachtung, geselligem Beisammensein, „Kaffeeklatsch“ und religiösem Ritual. Nebenbei gesagt, hatte das Christentum, das Ende des 16. Jahrhunderts eine kurze Blütezeit in Japan hatte, neben dem Zen großen Einfluss auf die Form der Teezeremonie. Gerade die Eucharistie-Feiern haben das Teezeremonie-Ritual mitgeprägt.
Als ich dann vor ungefähr 8 Jahren angefangen habe, das selbst zu lernen, habe ich gemerkt, dass es eine ungeheure Schulung in gestischer Konzentration und Reduktion ist, die sich von der Praxis der Teezubereitung auf die gesamte Aktivität auswirkt. Man merkt auf einmal, wie viel Unsinn man mit seinen Händen, ja seinem ganzen Körper tagtäglich veranstaltet.
SCHAU INS BLAU: Wird Ihr Schreibprozess von dieser Kultur beeinflusst?
CHRISTOPH PETERS: Schwer zu sagen. Im Prinzip kommen diese Ideen, dass man über tägliches diszipliniertes Üben und Lernen irgendwann nach vielen Jahren in ein Stadium gelangt, in dem man kontrolliert-frei/spontan-beherrscht seine Sätze aus einem Guss setzt oder seine Linien zieht, meiner Vorstellung der künstlerischen Prozesse sehr nahe. Dazu gehört auch, dass dieses Üben nicht im Äußerlichen stehen bleibt, sondern tatsächlich mit einer lebenslangen geistigen Entwicklung einhergeht.
SCHAU INS BLAU: Seit dem 18. Jahrhundert hat sich in Anlehnung an Johann Gottfried Herder ein Modell von Kultur etabliert, das Kulturen als in sich geschlossene Kugeln begreift. Der zeitgenössische Philosoph Wolfgang Welsch zieht dieses Modell mit seinem Begriff der Transkulturalität in Zweifel. Für ihn sind Kulturen keine in sich abgeschlossenen Kugeln, sondern sich gegenseitig bedingende Netzwerke. Findet sich Welschs Theorie in Ihrem Schreibstil wieder?
CHRISTOPH PETERS: Ich glaube ja sowieso nicht so sehr an die Gültigkeit von Theorien. Ein solches Kugelmodell halte ich für historischen und phänomenologischen Unsinn, und in seinen Auswirkungen für gefährlich: Unmittelbar auf die Fiktion, es gebe eine bestimmte in sich geschlossene niederrheinische, deutsche, christliche, islamische – was weiß ich was für – Kultur, folgt dann meist gleich die Verklärung der eigenen und Herabsetzung der anderen Kulturen. Die historischen Missionszüge, Konquistadoren, Kolonialisten, Volk-ohne-Raum-Ideologen sind immer davon ausgegangen, dass die Überlegenheit der eigenen, eben in sich geschlossenen Kultur die Unterdrückung, wenn nicht Auslöschung aller anderen gestattet. Da unterscheidet sich der KZ-Aufseher kaum vom französischen Algeriensoldaten und beide sind geistige Brüder des IS-Kämpfers. Aber auch das sind letzten Endes wahrscheinlich unzulässige Vergleiche – nicht, weil die einen schlimmer als die anderen waren – sondern weil historische Entwicklungen immer einmalig sind. Sie hängen von so vielen, letztlich nicht vergleichbaren Bedingungen ab, die sie gleichzeitig permanent erzeugen, dass sich da meines Erachtens so gut wie gar nichts über einen Kamm scheren lässt. Japan hat gut 200 Jahre lang versucht, sich als „Kugel“ zu verhalten, hatte aber in den Jahrhunderten davor nahezu in allen künstlerischen und geistigen Bereichen chinesische Formen und Konzepte importiert und adaptiert. China wiederum war maßgeblichen Einflüssen aus Indien ausgesetzt: Bodhidharma, der Gründer des Zen, war ein tamilischer Prinz, der nach China ging und dort sowohl die Praxis der Zen-Meditation als auch das Kung-Fu eingeführt haben soll, die dann zu Eckpfeilern der gesamten chinesischen und später japanischen Geisteswelt wurden. Dann kamen christliche Händler und Missionare, die wie schon erwähnt, nachhaltigen Einfluss auf die Form des japanischen Nationalrituals schlechthin – der Teezeremonie eben – hatten. Ab dem 19. Jahrhundert ist die Entwicklung der europäischen Moderne ohne den Einfluss japanischer Kunst, die auf den Weltausstellungen in Paris, London und Wien gezeigt wurde, komplett unvorstellbar und unverständlich. Van Gogh hatte japanische Holzschnitte im Atelier, die er auch immer wieder abgemalt hat, etc. Man kann das unendlich fortschreiben.
SCHAU INS BLAU: Wir empfinden gerade in „Herr Yamashiros bevorzugt Kartoffeln“, dass inhaltlich eine Verschmelzung der fremden Kultur mit der eigenen stattfindet und dadurch eine Art dritter Raum entsteht. Ist diese Vorstellung des dritten Raumes von Ihnen bewusst initiiert?
CHRISTOPH PETERS: Ich würde auch nicht von einem „dritten Raum“ sprechen, weil das wieder so eine Abgeschlossenheit suggeriert. Mein Bild wäre eher das einer weiten Ebene, auf der Strömungen mit offenen Rändern miteinander in einem permanenten Austausch und Wandel sind. Eher so wie das Wetter vom Satelliten aus gesehen sich darstellt, bloß etwas langsamer. Es gibt bestimmte, relativ starre Einflusspunkte – beim Wetter wären das Hochgebirge, Wüsten, große Gewässer – im Bereich des Geistig-Kulturellen die Weltreligionen und ihre Zentren, ökonomische und topographische Bedingungen, die diese oder jene Denkart befördern, aber eben weder räumlich noch zeitlich festschreiben.
SCHAU INS BLAU: Man unterstellt der japanischen Kultur einen gewissen Stoizismus, dessen Zweck es ist, das Gesicht zu wahren. Wie zeichnen Sie die unterschiedlichen Charaktere, deren Mentalitäten von außen nicht sichtbar sind?
CHRISTOPH PETERS: Ich lasse mich auch da eigentlich nicht von Zuschreibungen leiten, sondern die Figuren, die ich beschreibe, sind fast immer mehr oder weniger portraithafte Ableitungen von Leuten, denen ich begegnet bin oder von denen mir erzählt wurde. Wenn ich mich nicht täusche, beschreibe ich dann eher, wie sie sich konkret verhalten oder äußern, als dass ich Gefühlsbehauptungen über ihr Innenleben aufstelle.
SCHAU INS BLAU: Beim Lesen wirkte die Darstellung Ihrer Charaktere an manchen Stellen etwas überzeichnet. Vielleicht sogar stereotypisiert. Inwiefern lassen sich diese Stellen auch als Parodie verstehen?
CHRISTOPH PETERS: Ob etwas überzeichnet oder stereotyp wirkt, hängt ja oft auch von der Erwartung beziehungsweise der Vorkenntnis des einzelnen Lesers bzw. Betrachters ab. Innerhalb bestimmter inkulturierter Verhaltensweisen gibt es einerseits das, was man für „typisch japanisch“ bzw. „typisch deutsch“ hält, andererseits ist das in sich dann doch wieder sehr ausdifferenziert. Wer wenig über Deutschland oder Japan weiß, sieht die Binnendifferenzierung innerhalb einer Darstellung nicht, für ihn verhalten sich in der Realität wie in der Literatur erst mal alle „Asiaten“ vergleichsweise ähnlich fremd. Dementsprechend weiß ich also nie, wann es der irritierte Blick des (deutschen) Erzählers ist, der die Komik erzeugt, und wann das Verhalten der (japanischen) Figur selbst – meistens, glaube ich, entsteht die Komik im Zwischenbereich von beidem, und insofern bezieht sich auch das parodistische Moment implizit auf beides.
SCHAU INS BLAU: Könnte das auch als Satire verstanden werden?
CHRISTOPH PETERS: Dementsprechend wäre es dann eine Satire sowohl auf die Erwartung der deutschen Erzählstimme, die ja nicht mit „mir“ identisch ist und auch auf japanische Verhaltensmuster, die ebenfalls bestimmten Erwartungen unterliegen.
SCHAU INS BLAU: Bezugnehmend auf „Herr Yamashiro bevorzugt Kartoffeln“. Wie empfinden Sie das Verhältnis der Kulturen im Buch? Sehen Sie hier eine Art Transkulturalität?
CHRISTOPH PETERS: Ich kann die Frage eigentlich nicht beantworten, weil ich ja kein „Kulturenbuch“ geschrieben habe, sondern eine individuelle Geschichte – die des Keramikers Jan Kollwitz – als Ausgangspunkt hatte. Jan Kollwitz – und eben auch Ernst Liesgang – ist nun alles Mögliche, aber gewiss kein Repräsentant deutschen Wesens. Der ist nach Japan gegangen, um japanische Keramik zu lernen, war aber selbst schon vorher Zen-Praktizierender. Seine beiden Lehrer in Japan hatten mit diesem „Zen-Zeug“ gar nichts am Hut, sondern fanden das eher ein bisschen peinlich, dass dieser junge Deutsche sich an einer Geistigkeit orientierte, die sie als „moderne“, „aufgeklärte“ Japaner lange hinter sich gelassen hatten. Das bisschen Shinto-Praxis zur Bestechung des Ofengeistes ist ja eher Brauchtum als religiöser Akt. Ito Hidetoshis Vorbildfigur, Tokuro Kato, war übrigens im wirklichen Leben Christ.
SCHAU INS BLAU: Eine zentrale Rolle spielt der Anagama. Welchen Status hat der Ofen für Sie?
CHRISTOPH PETERS: Der Ofen ist einfach ein unglaublich eindrucksvolles Gebilde, sobald er Feuer hat. Die Erfahrung der Kraft, die da entfaltet wird, ist ja ganz unmittelbar körperlich, die wilden Flammenzungen, unglaubliche Hitze, gleißendes Licht, wenn man da bei über 1000 Grad hineinschaut. Naja. Und während gebrannt wird, arbeitet da nach verbreiteter Überzeugung eben ein Geist. Ich würde von meiner Erfahrung her denken, dass man dessen wie auch immer reale Anwesenheit durchaus annehmen kann.
SCHAU INS BLAU: Haben Sie selbst schon einmal – vielleicht sogar mit Jan Kollwitz zusammen – einen Anagama angefeuert? Die Brennart ist ein tagelanger, sehr aufwendiger Prozess. Welches Verhältnis entwickelt sich in diesen Tagen zu dem Ofen?
CHRISTOPH PETERS: Ich war bis jetzt bei vier Bränden von Jan Kollwitz’ Ofen dabei. Beim letzten Mal durfte ich auch selber feuern, unter Aufsicht, aber doch so, dass ich die Entscheidungen gefällt und versucht habe, mich in den Rhythmus, den der Ofen vorgibt, einzufinden. Einerseits hat man natürlich sehr großen Respekt vor dem Ofen, seiner Kraft und auch vor seiner Unberechenbarkeit, andererseits darf daraus aber auf keinen Fall Angst werden, denn dann wird man zögerlich und macht Fehler. Auf eine sonderbare Weise habe ich das Gefühl, der Ofengeist vertraut auch darauf, dass der, der feuert, sicher weiß, was jeweils zu tun ist, und wenn man ihn in diesem Vertrauen enttäuscht, nimmt er einem das übel.
SCHAU INS BLAU: Gerade bei dieser Art der Herstellung entstehen Objekte, deren Status man eventuell als transkulturell bezeichnen könnte. Wie sehen Sie die Erzeugnisse des Ofens? Sind es deutsche, japanische oder deutsch-japanische Keramiken?
CHRISTOPH PETERS: Wenn ein japanischer Dirigent mit japanischen Musikern Beethoven aufführt, ist es dann deutsche Musik oder japanische Musik oder transkulturell? – Jan Kollwitz’ Freund, Kazu Yamada, einer der berühmtesten Keramiker seiner Generation, der seinerzeit vermittelt hat, dass der japanische Ofenbauer nach Cismar kam und dort den Anagama gebaut hat, sagt, Jan Kollwitz mache japanische Keramik. Soweit ich weiß, ist die Technik des Anagama-Ofens allerdings im 5. Jahrhundert aus Korea nach Japan gekommen, ursprünglich entwickelt wurde sie in China, woran sich die Frage anschließt, ab wann etwas nicht mehr ein „Fremdkörper“ ist, der dem „Kulturraum“, aus dem er stammt, zugeschrieben wird, sondern als unveräußerlicher Teil des kulturellen Raumes gelten darf, in den er gelangt ist. Fast alle grundlegenden Texte des Zen stammen aus China, aber im China von heute spielt Zen vermutlich eine deutlich geringere Rolle als in Amerika. Aus Sicht des Zen würde man vielleicht sagen, „Zen ist immer, was es just dort ist, wo es gerade ist“. Und je nachdem, wer es dann gerade mit wem zu tun hätte, würde man für diesen Satz eine schallende Ohrfeige bekommen oder auch schallendes Gelächter ernten, ganz gleich ob man Amerikaner, Japaner, Deutscher oder Chinese wäre.
SCHAU INS BLAU: Herzlichen Dank für das aufschlussreiche Gespräch!
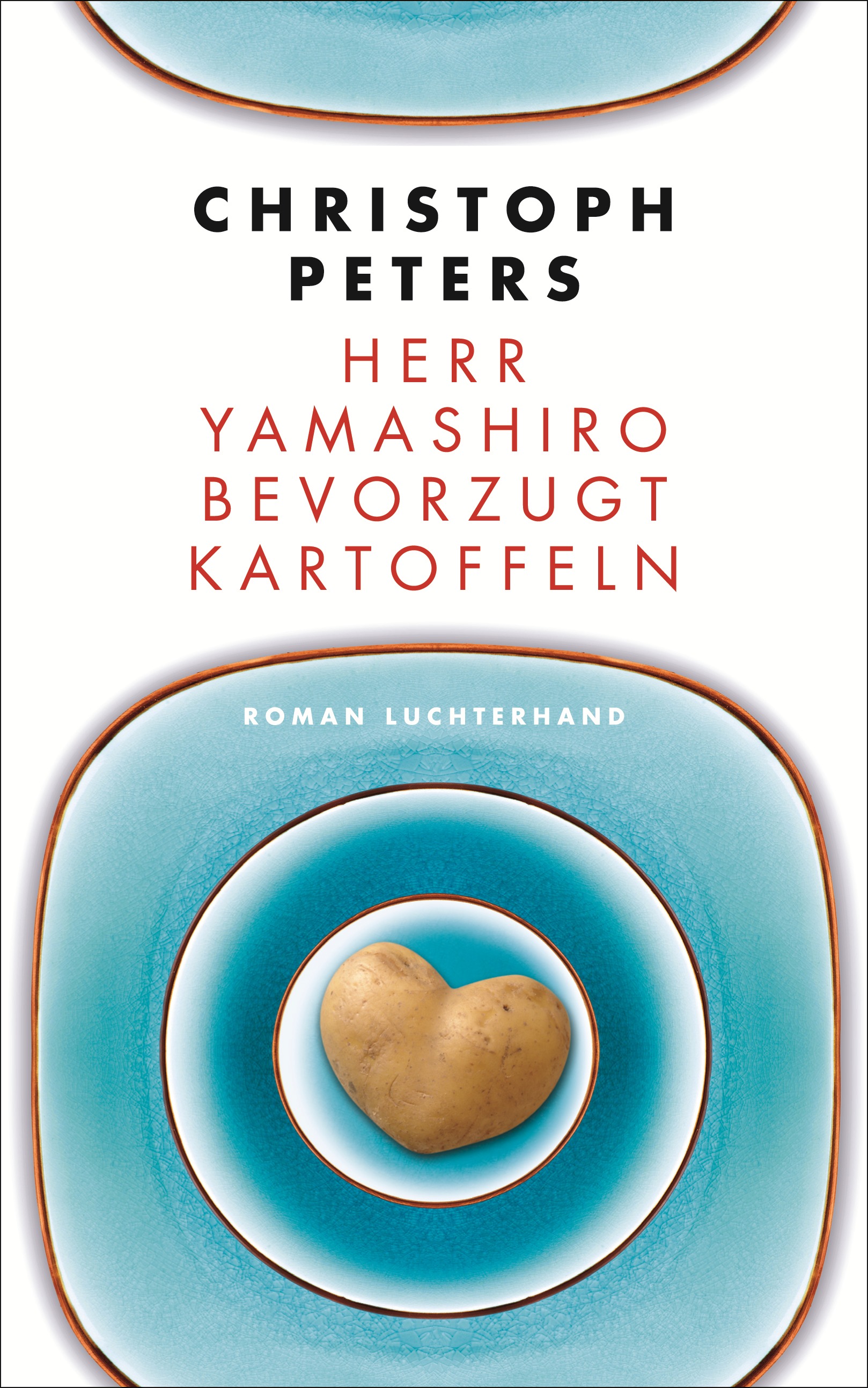
Peters, Christoph: Herr Yamashiro bevorzugt Kartoffeln, München: Leuterhand Literaturverlag 2014.
ISBN: 978–3‑630–87411‑1
Preis: 18,99 € (D) / 19,60 € (A) / 25,90 CHF (CH)

Christoph Peters wurde 1966 in Kalkar am Niederrhein geboren. Peters studierte Malerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe und ist seither als freischaffender Künstler und Schriftsteller tätig. 2004 hatte er die Poetikdozentur der Akademie der Wissenschaften und der Literatur der Universität Mainz inne. 2006 wurde er zum Museumsschreiber des Hetjens-Museums / Deutsches Keramik Museum in Düsseldorf ernannt. Zusammen mit dem indischen Schriftsteller Kiran Nagarkar hielt Christoph Peters 2008 die 22. Tübinger Poetik-Dozentur. Peters erhielt für sein Schreiben zahlreiche Auszeichnungen, darunter 1998 den Martha-Saalfeld-Förderpreis, 1999 den Aspekte-Literaturpreis und den Niederrheinischen Literaturpreis der Stadt Krefeld, 2000 den Georg‑K.-Glaser-Preis und 2009 den Rheingau-Literaturpreis.