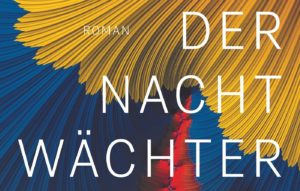Von Johannes Hofmann
In vielen Texten Kafkas können Tiere handeln und sprechen wie Menschen. In der Forschung werden sie dennoch kaum als Fabelwesen betrachtet. An Kafkas Erzählung „Eine Kreuzung” lässt sich zeigen, dass der Gattungsbegriff der Fabel erweitert werden sollte, um der ethischen Dimension der Fabel Rechnung zu tragen. Die wesentlichen Gattungskriterien der Fabel werden dabei beibehalten, jedoch, analog zu einer Ethik Kants, neu justiert: Die Moral der Fabel kommt nicht von Tieren, sondern mit Tieren.
1. Kafkas Tiere und die Fabel
Das akademische Interesse an Kafkas Tieren ist außerordentlich hoch, was nicht zuletzt darin begründet liegt, dass kein Autor der klassischen Moderne dem Tier so viel Raum gibt wie Franz Kafka (vgl. Thermann 2010: 12). Es lassen sich bei der Betrachtung seiner Texte jedoch kaum Generalisierungen finden, die seine Tierfiguren sowie deren Wesen und Funktion adäquat abbilden könnten, denn für gewöhnlich entziehen sich Kafkas Tiere globaler Anthropomorphisierungsmechanismen. Zudem verschieben sie die Grenze zwischen Mensch und Tier oder heben sie gar gänzlich auf, wobei das Sprachvermögen oftmals nur eine sekundäre Rolle spielt, da es in Kafkas Texten ohnehin nicht als anthropozentrisches Alleinstellungsmerkmal zur Abgrenzung zum Tier fungiert. Vielmehr fühlen und handeln Kafkas Tiere auch wie Menschen — und sind damit oftmals in ihrer Wertigkeit und in ihrer Individualität auf gleiche Stufe gestellt (vgl. Fingerhut 1969: 93).
Aufgrund ihrer Eigentümlichkeit lassen sie sich keiner literarischen Konventionen unterordnen, weswegen sie auch nur partiell im gattungsspezifischen und damit im intertextuellen (Tier-)Kontext diskutiert werden. Die dort ansässigen Fragestellungen werden gewöhnlich durch die Deutung individueller Tier-Instrumentalisierungen supprimiert, und der Versuch einer Systematisierung in Relation zu literarischen Spielräumen wird häufig unterlassen. Ein möglicher Grund dafür könnte die Unsicherheit über den Erkenntnisgewinn einer solchen gattungsspezifischen Untersuchung sein. Schließlich zeichnen sich Kafkas (Tier-)Texte durch ihre Vieldeutigkeit aus, sodass man sie durch Abstrahierung und Einbettung in einen literarischen Rahmen möglicherweise ihrer Entfaltungskraft berauben könnte.
Dennoch werden manche gattungsspezifischen Fragestellungen, unabhängig ihrer Praktikabilität, geradezu forciert. Sprechende und menschlich handelnde Tiere, die zudem oft in einem ethisch aufgeladenen Kontext auftreten, sind prima facie kaum aus der literarischen Gattungstradition der Fabel zu lösen. Mit welchen Komplikationen dies verbunden ist, zeigt sich bei dem Text „Kleine Fabel” ganz paradigmatisch. Er gehört wohl zu den bekanntesten Tier-Texten Kafkas und kann sich allein aufgrund des Titels keinem Fabelvergleich entziehen.
»Ach«, sagte die Maus, »die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, daß ich Angst hatte, ich lief weiter und war glücklich, daß ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah, aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, daß ich schon im letzten Zimmer bin, und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe.« – »Du mußt nur die Laufrichtung ändern«, sagte die Katze und fraß sie. (Kafka: Kleine Fabel, 326)
Obgleich „Kleine Fabel” einige der von Lessing konstatierten Fabelmerkmale aufweist (vgl. Allemann: 1983: 342), stellt sich dennoch die Frage, ob nicht andere Gattungskriterien unerfüllt bleiben oder sogar verkehrt werden. Diese Reflexion ergibt sich natürlich erst dann, wenn durch den Text diverse Kollationsmechanismen initiiert werden, welche die ursprünglichen Erwartungen an den Text aufdecken, indem dieselbigen nicht oder nur partiell erfüllt werden. In „Kleine Fabel” geschieht dies vor allem durch den spöttischen Rat der Katze und ihre unvermittelte Verspeisung der Maus; zudem wird der Fabelcharakter des Textes auch durch die „ganz anders geartete Überlegenheit” der Maus sowie durch die narratologisch induzierte Allwissenheit der Katze konterkariert (vgl. Fingerhut: 173). Der Text wird daher unter anderem nicht als Fabel bezeichnet, sondern als „Anti-Fabel” (Sudau 2008: 110) oder als Parabel (vgl. Fingerhut: 172).
Von gattungsspezifischer Einigkeit bei Kafkas Tier-Texten kann, selbst bei dieser sehr fabeltypischen Instrumentalisierung von Tieren, nicht die Rede sein. Kafkas Tiere werden daher in der Forschung meist nicht im Fabelkontext diskutiert. Dass es trotzdem sinnvoll sein kann, die Fabel als literarischen Deutungsraum für Kafkas Tier-Texte heranzuziehen, zeigt sich unter anderem an deren ethischer Dimension.
2. Kafkas Tiere und die Ethik
Christine Lubkoll löst sich bei ihrer Untersuchung von Kafkas Tieren von gattungsspezifischen Fragestellungen und verweist vielmehr auf drei ethische Reflexionsebenen, die sich bei Kafkas literarischem Umgang mit Tieren abzeichnen: Erstens gebe es tierethische Textinterpretationen (mit potentiellen außertextlichen Implikationen), die Fragen nach einem angemessenen Umgang mit Tieren aufwerfen; zweitens würden Kafkas Texte die Wahrnehmung, Darstellung und Darstellbarkeit von Tieren aus menschlicher Sicht hinterfragen; und drittens gehe es um die aporetische Forderung, Tiere frei jeglicher verstellter Naturvorstellungen abzubilden (vgl. Lubkoll 2015: 156f). Diese Ebenen stehen, wie Lubkoll erkennt, in einem gegenseitigen Bezugsverhältnis und sind zudem weiter unterteilbar. Dennoch zeigen sie deutlich, dass sich die Bedeutung von Kafkas Tieren stets in einem ethischen Kontext manifestiert.
Der Anthropozentrismus, der sich in den von Lubkoll herausgearbeiteten Reflexionsebenen erkennen lässt, findet sich auch in der Tierethik Immanuel Kants wieder. Für Kant liegt der ethische Umgang des Menschen mit dem Tier ausnahmslos in der Reflexivität begründet, denn „seine vermeintliche Pflicht gegen andere Wesen ist bloß Pflicht gegen sich selbst” (Kant 1959: 295). So können nicht- menschliche Wesen „für Kant allenfalls Anlass moralischer Reflexion, nicht aber deren Gegenstand sein” (Borgards 2015: 175). Somit werden literarische Begegnungsorte von Mensch und Tier in Anlehnung an Kant zu „Probebühnen, auf denen sich die Praxis zwischenmenschlichen Handelns üben lässt” (ebd.: 176). Mit Bezug auf Lubkoll und Kant lässt sich die Gattung Fabel also umdenken, sodass die wesentlichen Gattungsmerkmale erhalten bleiben, aber eine neue Ausrichtung erfahren.
3. Die Fabel als ethische Probebühne
Ähnlich wie bei anderen Gattungen, handelt es sich bei der Fabel um einen nicht fixierten literarischen Reflexionsraum, in dem sich prototypische Charakteristika nur bedingt festlegen lassen. Laut des Gattungstheoretikers Rüdiger Zymner ist neben dem (global) anthropomorphisierten Tier vor allem ein Anwendungssignal konstitutiv, welches sich als Lehre oder Moral zu erkennen gibt (vgl. Zymner 2009: 234). Doch selbst diese Minimalkriterien bedürfen einer Auslegung, wobei unter anderem der Grad der Anthropomorphisierung, die Erkennbarkeit des Anwendungssignals, und die Qualität der metaphorischen Übertragbarkeit stets relativ bleibt. Zudem werden alle Gattungskriterien durch die narrative Dimension des Textes wesentlich tangiert.
Stephanie Waldow hat diesbezüglich in einer diachronen, poetologischen Reflexion verschiedene Fabeltheorien kontrastiert und dabei deren ethische Dimensionen herausgearbeitet. Dabei zeigt sich, dass die Fabel nicht als literarischer Begegnungsort verstanden werden muss, an dem anthropomorphisierte Tiere ethische Wahrheiten unterbreiten. Vielmehr handle es sich bei der Fabel um einen „ethischen Aushandlungsort über die Grenzen des Menschlichen und Tierischen” (Waldow 2015: 148), wo „[d]as Alleinstellungsmerkmal des Menschen als sprachliches, vernunftbegabtes und in der Folge moralisch handelndes Subjekt […] in Frage gestellt” (ebd.: 147) wird. Die ethische Dimension der Fabel manifestiert sich somit nicht zwingend durch das Anthropomorphisierte, sondern in der Anthropomorphisierung selbst, und dabei „erweist sich die Fabel als innovatives Format, um bestehende Machtdiskurse zu hinterfragen” (ebd.: 149).
Indem die ethische Dimension der Fabel in den Vordergrund gerückt wird, lassen sich neue Kontexte erschließen, die den Menschen und den Anthropozentrismus integrieren und zugleich hinterfragen. Vor diesem Hintergrund erscheint ein Fabelbegriff, der ausschließlich anthropomorphisierte Tiere in moralisierender Erscheinung impliziert, obsolet.
4. Kafkas „Eine Kreuzung” als Fabel
„Eine Kreuzung” ist einer der am wenigsten beachteten Tier-Texte Kafkas. Zudem zeigt sich, dass die Auslegung des Textes oft gleichgestellt wird mit der Auslegung allegorischer Elemente, die dabei einer zirkularen Erkenntnissuche gleichkommt: Mithilfe von Kafkas Biografie soll „Eine Kreuzung” gewissermaßen entschlüsselt werden, um dabei wiederum Erkenntnisse über Kafka selbst zu gewinnen. Das Mischtier in der Erzählung wird in diesem Sinne nicht selten als Verkörperung der dichotomen Identität Kafkas oder als „Ausdruck des Selbstwiderspruchs im Menschen” (Emerich 1965: 140) gelesen. Was ein Tier-Text Kafkas bedeutet spielt oft eine größere Rolle als wie der Text Bedeutung generiert.
Im Folgenden soll gezeigt werden, dass sich in „Eine Kreuzung” alle der von Lubkoll konstatierten Reflexionsebenen befinden und sich diese im gattungsspezifischen Kontext der Fabel besonders produktiv entfalten. Der Text lässt sich somit als Demonstration eines radikalen Machtdiskurses lesen, der, zusätzlich zum Sprachvermögen, in der Möglichkeit der Anthropomorphisierung begründet ist.
4.1 Aus ruhigen Tieraugen und der Respekt vor dem Unfasslichen
Die Erzählung beginnt mit einer naturalistischen Darstellung des eigentümlichen Tiers, welches sich im Besitz des Erzählers befindet [Da in der Erzählung „Eine Kreuzung” das biologische Geschlecht der narrativen Instanz durchweg unbestimmt bleibt, soll im Folgenden Susan S. Lansers narratologisches Beschreibungsprinzip angewandt werden: Das biologische Geschlecht des Autors (Franz Kafka) bestimmt in der Bezugnahme auf die narrative Instanz (zumindest) das grammatikalische Geschlecht, d.h. „er” — „der Erzähler”]. Dabei tritt vor allem Kafkas „Sprache des neutralen Ausdrucks” (Kraft 1972: 20) in Erscheinung, die eine scheinbar entemotionalisierte Haltung des Erzählers gegenüber seinem Tier widerspiegelt. Der Fokus liegt dabei merklich auf der Gegenüberstellung von Oppositionen, die sich vorerst fast ausschließlich auf äußerlich wahrnehmbare Beobachtungen stützen.
Nach einem früheren Ungleichgewicht setzt sich das Tier laut Erzähler nun gleichermaßen aus Lamm und Katze zusammen. Kopf und Krallen entsprechen der einer Katze, Größe und Gestalt hingegen sind vom Lamm; das Fellhaar ist knapp, aber trotzdem weich; das Tier bewegt sich hüpfend und schleichend; es schnurrt auf dem Fensterbrett und lässt sich auf der Wiese nicht mehr einfangen; „vor Katzen flieht es, Lämmer will es anfallen” (Kafka: Eine Kreuzung, 295) [In diesem Kontext scheint das Modalverb „wollen” kein Anzeichen auf Anthropomorphismus zu sein. Eher handelt es sich hier um die Beschreibung von äußerlich wahrnehmbaren Verhaltensmustern des Tiers]; es sitzt stundenlang neben dem Hühnerstall auf der Lauer, nimmt Mordgelegenheiten aber dann doch nicht wahr; süße Milch saugt es in langen Zügen über Raubtierzähne hinweg in sich ein. Nur vereinzelt lassen in der äußerlichen Beschreibung des Tiers kaum ausgeprägte Projektionsmechanismen erkennen. So sollen die Augen des Tiers „flackernd und wild” (ebd.) sein; miauen soll es nicht können [Es bleibt hier unklar, ob das Tier tatsächlich nicht miauen kann oder es einfach nicht tut] und vor Ratten soll es Abscheu haben.
Obwohl durch die Beschreibung der Inhomogenität gleich zu Beginn der Erzählung ein immenses Projektionspotential generiert wird, erklärt der Erzähler seinen uneingeschränkten Respekt vor der Eigentümlichkeit des Tiers:
Natürlich ist es ein großes Schauspiel für Kinder. Sonntag Vormittag ist Besuchstunde. Ich habe das Tierchen auf dem Schoß und die Kinder der ganzen Nachbarschaft stehen um mich herum. Da werden die wunderbarsten Fragen gestellt, die kein Mensch beantworten kann: Warum es nur ein solches Tier gibt, warum gerade ich es habe, ob es vor ihm schon ein solches Tier gegeben hat und wie es nach seinem Tode sein wird, ob es sich einsam fühlt, warum es keine Jungen hat, wie es heißt und so weiter. Ich gebe mir keine Mühe zu antworten, sondern begnüge mich ohne weitere Erklärungen damit, das zu zeigen, was ich habe. (ebd.)
In dieser zentralen Textstelle handelt es sich um die von Lubkoll konstatierte Reflexionsebene, in der jeglicher Anthropomorphismus verneint wird und die Forderung gestellt wird, „das Tier Tier sein zu lassen, aber eben nicht nach von Menschen gemachten und gedachten Maßgaben und Maßstäben” (Lubkoll: 157). Dies geschieht hier zudem in universalisierender Manier: Der Erzähler erklärt nämlich jegliche Fragen nach dem Sein des Tiers nicht nur als subjektiv, sondern auch als objektiv unbeantwortbar, denn kein Mensch könne Antworten auf die sonderbaren Fragen der Kinder geben. Die Spezifizierung der Fragen als „sonderbar” ist jedoch ihrerseits sonderbar, denn schließlich sind die Fragen, besonders für Kinder, nicht ungewöhnlich und teilweise sehr wohl beantwortbar. Dass der Erzähler selbst die Frage nach dem Namen der Kreuzung als sonderbar betrachtet, zeigt die allumfassende Ablehnung der Vermenschlichung des Tiers. Es ist zudem möglich, dass der Erzähler hier die Fragen nicht wortwörtlich versteht und sich, vielleicht im Gegensatz zu den Kindern, der Transfersignale in die anthropozentrische Ontologie bewusst ist. Die Fragen der Kindern lassen sich offensichtlich auch für den Menschen anwenden, obwohl sich dort erwartungsgemäß eine ähnliche Aporie abzeichnet: Wo kommen wir her? Was machen wir hier? Was passiert nach dem Tod? Und so weiter. Der Erzähler hüllt sich jedoch in Akzeptanz des Nichtwissens und nimmt die Möglichkeit zum Machtdiskurs nur in sofern wahr, dass er ihn nicht wahrnimmt.
Der Akzeptanz des Erzählers wird die Ungenügsamkeit der Kinder entgegengesetzt. Da ihre Fragen vom Erzähler nicht beantwortet werden (können), versuchen sie Identifikationsprozesse zu initiieren, die möglicherweise Aufschluss über das Dasein des Tiers geben könnten:
Manchmal bringen die Kinder Katzen mit, einmal haben sie sogar zwei Lämmer gebracht. Es kam aber entgegen ihren Erwartungen zu keinen Erkennungsszenen. Die Tiere sahen einander ruhig aus Tieraugen an und nahmen offenbar ihr Dasein als göttliche Tatsache gegenseitig hin. (Kafka: Eine Kreuzung, 195)
Der Mensch, so wird in der Textpassage deutlich, scheint hier dem Tier aufgrund seines unstillbaren Erkenntnisdrangs sogar unterlegen zu sein, denn er wird Opfer seiner selbst, wohingegen Tiere in der Lage sind, (göttliche) Tatsachen als solche anzunehmen.
Die Tieraugen, aus denen sich die Katzen und Lämmer gegenseitig ansehen, können hier als Symbol für die Negation intersubjektiver Bewusstseinserfahrungen gelesen werden. Der Philosoph Thomas Nagel begründet in seiner philosophischen Abhandlung “What it is like to be a Bat?”, dass es trotz komplexester Perspektivierungsversuche unmöglich sei, jemals ein anderes Bewusstsein als unser eigenes zu haben oder zu erfahren. Diese Erkenntnisse betreffe natürlich nicht nur das Verhältnis zwischen Mensch und Tier, sondern auch das Verhältnis zwischen Mensch und Mensch (vgl. Nagel 2016: 18). Die Augen und die Wahrnehmung des Anderen bleiben immer dem Anderen vorbehalten; der intersubjektive Perspektivenwechsel wird immer ein unerfüllter Wunsch bleiben. Der Erzähler in „Eine Kreuzung” erkennt dies zu Anfang als Wahrheit an und begreift seine Kreuzung als „das schlechthin Andere, Unbegreifliche, in sich selbst Widerspruchsvolle” (Emerich: 138). Im weiteren Verlauf des Textes wird diese Position jedoch aufgegeben und der Erzähler versucht dennoch, durch die Augen der Kreuzung zu sehen.
4.2 Sonderbare Fragen und der Anthropomorphismus
In ziemlich genau der Mitte des Textes wird narratologisch eine signifikante Bewusstseinsveränderung des Erzählers deutlich. Die anfängliche, überwiegend naturalistische, Beschreibung seines Tieres verändert sich abrupt zu einer anthropomorphisierten: Der Respekt vor dem Unfasslichen wird unvermittelt aufgegeben. Lubkolls zweite Reflexionsebene, welche die Frage der Wahrnehmung, Darstellung und Darstellbarkeit von Tieren aus menschlicher Sicht betrifft, zeigt sich vor allem durch den starken Projektionswunsch des Erzählers und dessen vollständige Auflösung der Grenze zwischen Mensch und Tier.
Der Erzähler beginnt diesen zweiten Abschnitt des Textes mit der psychischen Verfasstheit seiner Kreuzung und verweist dabei kaum auf Evidenzen, sondern zieht lediglich subjektive Eindrücke heran. So kenne das Tier im Schoß des Erzählers weder Angst noch Verfolgungslust (Kafka: Eine Kreuzung, 295f.). Bemerkenswert ist hier vor allem, dass der Erzähler von einer „Familie” und „uns” spricht, wo das Tier am besten aufgehoben sein soll. Wer diese Familie ist und wie sie sich zusammensetzt, bleibt unklar. Lediglich ein Hierarchieverhältnis zwischen Familie und Tier ist zu erkennen. Trotz der Vermenschlichung der Kreuzung werden die Gefühle der Kreuzung vom Erzähler als „richtige[r] Instinkt eines Tieres” (ebd.: 296) bezeichnet, wodurch der Erzähler kurzzeitig sein Wissen um die Grenze zwischen Mensch und Tier andeutet.
Dennoch wird diese Grenze zunehmend aufgelöst — sowohl auf materialistischer als auch auf geistiger Ebene:
Manchmal muß ich lachen, wenn es mich umschnuppert, zwischen den Beinen sich durchwindet und gar nicht von mir zu trennen ist. Nicht genug damit, daß es Lamm und Katze ist, will es fast auch noch ein Hund sein. — Einmal als ich, wie es ja jedem geschehen kann, in meinen Geschäften und allem, was damit zusammenhängt, keinen Ausweg mehr finden konnte, alles verfallen lassen wollte und in solcher Verfassung zu Hause im Schaukelstuhl lag, das Tier auf dem Schoß, da tropften, als ich zufällig einmal hinuntersah, von seinen riesenhaften Barthaaren Tränen. — Waren es meine, waren es seine? — Hatte diese Katze mit Lammesseele auch Menschenehrgeiz? (ebd.)
Die Vermenschlichung des Tiers geht so weit, dass es dem Erzähler sichtlich schwer fällt, zwischen den eigenen Tränen und denen des Tiers zu differenzieren. Durch den Machtdiskurs des Erzählers findet nahezu eine Synthese aus Kreuzung und Mensch statt. Die Grenze zwischen Mensch und Tier ist in diesem Stadium der Erzählung außerordentlich fragil beziehungsweise fast aufgelöst.
Die Projektionsflächenerweiterung auf den Hund kann zudem als eine Erweiterung des Anthropomorphismus auf die sprachliche Ebene gesehen werden:
Manchmal springt es auf den Sessel neben mir, stemmt sich mit den Vorderbeinen an meine Schulter und hält seine Schnauze an mein Ohr. Es ist, als sagte es mir etwas, und tatsächlich beugt es sich dann vor und blickt mir ins Gesicht, um den Eindruck zu beobachten, den die Mitteilung auf mich gemacht hat. Und um gefällig zu sein, tue ich, als hätte ich etwas verstanden, und nicke. — Dann springt es hinunter auf den Boden und tänzelt umher. (ebd.)
Obwohl sich hier die Grenze zwischen Mensch und Tier durch die Scheinkommunikation noch weiter aufzulösen scheint, findet eine klare Rückbesinnung des Erzählers auf die anthropologische Differenz statt. Man könnte diesen Vorgang als eine besondere Form der Projektion betrachten und ihn als rekursiven Anthropomorphismus bezeichnen: Der Erzähler nimmt die anthropologische Differenz zwischen Mensch und Tier scheinbar ungetrübt wahr und verlässt damit vorerst bewusst die Ebene der Projektion. Dadurch, dass er dem Tier zuliebe jedoch etwas vorspielt, sodass er als verständiger Gefährte gilt, stellt sich der einst überkommene Anthropomorphismus als unbewusst wiederkehrend heraus. Das Prinzip des rekursiven Anthropomorphismus ist dahingehend besonders interessant, weil es aufzeigt, dass die Ebene der Projektion nicht verlassen wird. Auf abstrakter Ebene stellt sich zudem die Frage, ob sie vom Menschen je verlassen werden kann.
4.3 Das erlösende Messer und die Tierethik
In den letzten Zeilen des analytisch-achronologischen Reflexionsprozesses zeigt sich eine Rückbesinnung des Erzählers auf die Herkunft der Kreuzung:
Vielleicht wäre für dieses Tier das Messer des Fleischers eine Erlösung, die muß ich ihm aber als einem Erbstück versagen. Es muß deshalb warten, bis ihm der Atem von selbst ausgeht, wenn es mich manchmal auch wie aus verständigen Menschenaugen ansieht, die zu verständigem Tun auffordern. (ebd.)
Sowohl die Mordfantasie als auch die Verschonung des Tieres aufgrund des Erbstück-Daseins werfen Fragen der Tierethik auf und lassen sich somit unter Lubkolls letzter Reflexionsebene fassen: Wie ist der Umgang mit dem Tier aus ethischer Perspektive zu beschreiben und zu bewerten?
Die Motivation zur Tötung liegt in der Vermenschlichung des Tiers begründet: „Es hat beiderlei Unruhe in sich, die von der Katze und die vom Lamm, so verschiedenartig sie sind. Darum ist ihm seine Haut zu eng” (ebd.). Es ist das Mitgefühl und der Wille zur Gnade, was den Erzähler zur Tötung der Kreuzung antreibt — und somit keine grundsätzlich böse Absicht. Es handelt sich hierbei nichtsdestotrotz um eine Rechtfertigung, die einzig und allein vom individuellen Anthropomorphismus getragen wird; ihr ethischer Wert ist durch diese Labilität daher grundlegend zu hinterfragen.
Im Gegensatz dazu steht die Motivation zur Verschonung der Kreuzung. Sie entspringt gänzlich außerhalb jeglicher Projektionsmechanismen und resultiert in dem Verweis auf ein vom Menschen gemachtes Regelsystem, dessen (normative) Ethik zwar ersichtlich wird, aber deren Hintergrund gänzlich unerklärt bleibt: Das Dasein als Erbstück (des Vaters) rechtfertigt das Dasein — und stellt dieses unter Schutz; das Dasein selbst ist nicht generell schützenswert. Letzten Endes nimmt der Erzähler aus Respekt vor diesem ‘Gesetz’ die Tötung aus Mitgefühl nicht vor.
Roland Borgards verweist diesbezüglich vor allem auch auf die Ambivalenz im ethischen Umgang mit dem Tier. So könne sich für Kant Moralität auch in der Tötung eines Tieres zeigen; entscheidend sei lediglich die Begründung der Tötung und die Vorgehensweise (vgl. Borgards: 177). Die Reflexion über das Töten wäre somit die entscheidende moralische Handlung, nicht das Töten oder Nicht-Töten des Tiers. Vielleicht, so könnte man argumentieren, ist die Verschonung der Kreuzung hier sogar unmoralisch, da keine Reflexion des Erzählers über den moralischen Wert der Verschonung stattfindet. Der Erzähler handle demnach nicht als moralisch verantwortliches Wesen. Bemerkenswert ist diesbezüglich vor allem, dass sich die Motivation zur Tötung der Kreuzung ethisch reflektierter darstellt als dessen Verschonung.
5. Schlussbetrachtung
Obwohl jede Systematisierung naturgemäß nicht alle Tiertexte Kafkas gleichermaßen abbilden kann, zeigt sich in „Eine Kreuzung” ein verdichtetes Zusammenspiel der von Lubkoll herausgearbeiteten Reflexionsebenen: „das Eintreten für die Tierwürde, das Aufdecken der Projektionsmechanismen und der Respekt vor der unergründlichen ‚Natur’ des Tiers” (Lubkoll: 159). Die ethische Vielschichtigkeit des Textes wird zudem dadurch gesteigert, dass es sich bei dem Tier um eine Kreuzung aus Lamm und Katze handelt und somit besonders viel Projektionsfläche offeriert.
„Eine Kreuzung” ist deswegen gewiss noch keine Fabel — zumindest nicht im ‘klassischen’ Sinne. Doch wie sich in der vorangegangen Analyse zeigt, hat eine gattungsspezifische Untersuchung hinsichtlich der Fabel auch bei Texten ihre Berechtigung, die vordergründig keine, nur schwach ausgeprägte, oder verzerrte Elemente der Fabel aufweisen. Das anthropomorphisierte Tier wird hierbei nicht als Voraussetzung für die Ethik herangezogen, die Ethik zeigt sich in der Anthropomorphisierung selbst.
Bevor in „Eine Kreuzung” die Grenze zwischen Erzähler und Mischtier fast gänzlich verschwindet, wird die anthropologische Differenz gewahrt und ein ausgeprägter Machtdiskurs vermieden. Erst durch die Anthropomorphisierung kann sich der Wunsch des Erzählers einstellen, die Kreuzung töten zu lassen. Die Kreuzung selbst entzieht sich jeglicher moralischer Bewertung, denn Begriffe wie „gut” oder „böse” können nicht sinnvoll appliziert werden. Erst durch den Umgang des Erzählers mit der Kreuzung wird ein ethischer Kontext generiert, in dem sich Moral und ethische Reflexion nicht von Tieren erlernen lässt, sondern mit ihnen.
Literaturhinweise:
- Allemann, Beda: Kafkas kleine Fabel. In: Hasubek, Peter (Hg.): Fabelforschung. Darmstadt 1983. S. 337–362.
- Borgards, Roland: Robinson und die Schule des Tötens. Tierschlachtungen bei Daniel Defoe, Joachim Heinrich Campe, Karl Wesel und Michel Tournier. In: Waldow, Stephanie (Hg.): Von armen Schweinen und guten Vögeln. Tierethik im kulturgeschichtlichen Kontext. Band 10. Paderborn 2015. S. 175–186.
- Emrich, Wilhelm. Franz Kafka. Frankfurt am Main 1965.
- Fingerhut, Karl-Heinz: Die Funktion der Tierfiguren im Werke Franz Kafkas. Bonn 1969.
- Kafka, Franz: Eine Kreuzung. In: Franz Kafka. Die Erzählungen. Frankfurt am Main 1961. S. 295–6.
- Kafka, Franz: Kleine Fabel. In: Franz Kafka. Die Erzählungen. Frankfurt am Main 1961. S. 326.
- Kant, Immanuel: Metaphysik der Sitten. Herausgegeben von Karl Vorländer. Hamburg 1959.
- Kraft, Herbert. Kafka. Wirklichkeit und Perspektive. Bebenhausen 1972.
- Lubkoll, Christine: Von Mäusen, Affen und anderem Getier. Kafkas narrative Ethik zwischen Anthropologie und Diskurskritik. In: Waldow, Stephanie (Hg.): Von armen Schweinen und guten Vögeln. Tierethik im kulturgeschichtlichen Kontext. Band 10. Paderborn 2015. S. 155–74.
- Nagel, Thomas: What is it like to be a bat? Wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Übersetzt von Ulrich Diehl. Stuttgart 2016.
- Ralf Sudau, Franz Kafka: Kurze Prosa/ Erzählungen. 16 Interpretationen. Stuttgart 2008.
- Thermann, Jochen: Kafkas Tiere. Fährten, Bahnen und Wege der Sprache. Marburg 2010.
- Waldow, Stephanie: Von schlauen Füchsen und sprechenden Pferden. Die Fabel als Animots. In: Waldow, Stephanie (Hg.): Von armen Schweinen und guten Vögeln. Tierethik im kulturgeschichtlichen Kontext. Band 10. Paderborn 2015. S. 141–154.
- Zymner, Rüdiger: Fabel. In: Lamping, Dieter (Hg.): Handbuch der literarischen Gattungen. Stuttgart 2009. S. 234–39.

Johannes Hofmann, geboren 1989, studierte an der Uni Regensburg Anglistik, Philosophie und Deutsch als Fremdsprache. In seiner Abschlussarbeit beschäftigte er sich mit Moralkonzeptionen der literarischen Moderne zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Während des Studiums arbeitete er unter anderem als Lehrbeauftragter am Zentrum für Sprache und Kommunikation der Uni Regensburg sowie als Deutschlehrer am Goethe-Zentrum in Kapstadt und am Elite-Internat St Peters in York. Mit besonderem Schwerpunkt auf Themen der Angewandten Ethik (Bioethik, Tierethik, Medienethik), absolviert er seit 2016 den interdisziplinären Masterstudiengang „Ethik der Textkulturen“ in Augsburg.