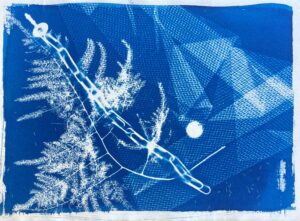© Lukas Schepers
von Mesut Bayraktar
Da liegst du, allein, in einem Zuhause, das euer gemeinsames war. Dein Körper befindet sich auf einer Matratze, die auf dem Boden ist. Du bist in sowas wie einem Wohnzimmer, zumindest umzingelt von vier Wänden, die du nicht verlassen willst. Sie sind dir fremd, und doch vertraut. Du willst Gefangener deines Gedächtnisses bleiben, ahnst du doch, was Gegenwart heißt: ein Jetzt, auf das ein Jetzt folgt, auf das ein Jetzt folgt, auf das ein Jetzt folgt. Rechts von dir ist eine schwarze Couch, links sind Schränke, worin Bücher hocken und neugierige Blicke auf dich werfen, die dich nichts angehen. Vor dir ist eine Wand mit zwei großen Fenstern, die über die Dächer der Nachbarshäuser blicken und ihre Horizonte auf Wolkenketten heften, die glanzlos durch die Weite wandern, ohne zu grüßen. Du siehst bloß vereinzelte Schneeflocken, die sie hinterlassen, und denkst, dass Sterne vom Himmel fallen. Gerne würdest du sie mit den Händen auffangen. Aber lässt du es, zündest noch eine Zigarette an und bleibst auf der Matratze liegen, wo dich eine samtene Leere bedeckt.
Der Sinn eines Uhrzeigers ist dir abhandengekommen. Vielleicht ist es Tag, vielleicht ist Nacht, vielleicht die wundersame Röte dazwischen, die zuweilen violett schimmert. Jedenfalls sind Stunden, Tage, Wochen verstrichen. Zeit hat sich gestreckt in Raum, in den sie geflohen ist wie ein verwundetes Tier in eine Höhle. Sie verharrt in Raumzeit. Zur Arbeit bist du nicht gegangen und das, was Hunger heißt, verspürt dein Körper seither auch nicht mehr, der mit Wein und Wasser auskommt. Die Erinnerung mergelt deinen Körper von Innen aus und so sehr es dich auch verwundert: Dir gefällt, dass sich ein Messer in deinem Bauch als Zeichen deiner Existenz windet. Irgendwas stirbt in dir und das bedeutet, dass du lebst. Nur Lebendiges kann Sterben empfinden. Während du aus den Fenstern guckst, dreht sich dein Blick nach und nach in dein Genick und ein Strom von Bildern zieht an dir vorbei. Liegend rollt dir eine Träne über die Wange, die du nicht bemerkt hast. Du wischst sie mit der Hand weg. Du lernst, dass man Tränen verlieren kann, ohne dass man weint. Es gibt Blut, das ausdringt, ohne dass es dafür offene Wunden braucht. Dieses Blut schmeckst du.
Vor einigen Tagen, Wochen oder Stunden hast du dir die Bilderrahmen an der Wand angeschaut, die neben den Bücherregalen das Fresko einer Welt bilden, die sich verflüchtigt wie Nebelschwaden über einem See, sobald Tag wird. In einem Bilderrahmen war ein Foto von einer Frau, die sich mit gesenktem Kopf über eine Wiese hockt. Sie sammelt Gänseblumen, um sie zu einer Krone zusammenzubinden, die sie dir aufsetzen wird. Das war ein Sonntag. Ihr hattet euch neu kennengelernt und an irgendeinem Samstag davor hat sie bei dir geschlafen. Ihr habt in dieser Nacht das Unmögliche bezwungen, indem ihr der Einsamkeit entkommen seid, vor der es kein endgültiges Entkommen gibt. Am folgenden Tag wart ihr spazieren. Ihr gingt durch einen Park, wo alte Bäume ins Blaue ragten. Ihr mochtet es, euch in den Schatten der Wipfel zu stellen und dem Rasseln der Blätter zu lauschen, wenn der Frühling Wind in die Äste pustete. Dabei lösten sich einige ihrer kastanienbraunen Haarsträhnen und flatterten über ihre Stirn. Lächelnd strich sie die Strähnen hinter ihr Ohr und sah dich dabei an. Du nahmst ihre Hand und ihr gingt weiter. Am See habt ihr Schwänen zugesehen und Enten Brotkrümel zugeworfen. Kam ein Vogel, streckte sie ihren Zeigefinger und rief den Namen aus. Nur den Spatz kanntest du, die anderen waren für dich namenlos. Die Vögel hatten dich nicht beeindruckt. Deine Gedanken waren noch bei den Strähnen, die der Frühling über ihre glatte Stirn legte.
Ihr ward lange spazieren, durch eine Baumallee, über abstehende Wurzeln, an Baumstümpfen vorbei, durch ein Spielplatz, hinter den Rücken von Anglern und Wassersportlern entlang, die am See saßen, auf dem die Sonne perlte. Schließlich kamt ihr an jener Wiese an, wo sie Gänseblumen sammelte und du dieses Foto geschossen hattest. Anschließend lag dein Kopf auf ihrem Schoß und sie strich mit ihrer Hand durch dein Haar. Das nanntest du Geborgenheit.
Irgendwann nahmst du einen anderen Bilderrahmen in die Hand. Darin war ein Foto, auch von ihr. Sie trug ihre Haare kürzer als üblich, nackenfrei. Seitlich blickt sie dich an. Ihre Knie sind angewinkelt und auf ihrem rechten biegt sich ihr Ellbogen in Richtung ihres Kinns. Zwischen Zeige- und Mittelfinger sitzt eine glimmende Zigarette. Ihre Lippen saugen an der Zigarette und ihre Bluse ist dunkelblau. Von der Seite segelt das Licht einer ungreifbaren Laterne über ihr Haar. Da es Abend war, ist das Foto etwas unscharf, aber eben darum scheint ihr helles Gesicht um so klarer hervor, worin ihre Lider wie gestrickte Gardinen halb über ihre braunen Augen liegen, die einen leichten Grünstich haben. Als eine Frau mit Hoffnungen und Zweifeln, mit Wünschen und Ängsten, mit Stärken und Schwächen blickt sie dich an, als wolle sie sich an dir festhalten.
Das war irgendwo im Süden, wo der Seetang vom Mittelmeer in den Gassen zu riechen ist. Ihr saßt in einer Bar und trankt Alkohol, nicht wenig. Am Tag lagt ihr noch auf einer Sandbank, beschattet von einem Schirm, und hörtet die Rufe der Wellen, die aus der Tiefe aufstiegen und eine unbekannte und mächtige Stimme an die Küsten hoben, sobald die Boten schäumend über das Festland brachen. Ihr versuchtet diese Rufe zu entziffern, aber vergeblich. Ihr musstet scheitern, aber ihr fandet Zuversicht darin, dass ihr die Rufe jener Tiefe vernommen hattet, die sonst nur Matrosen bekannt sind. Am Abend desselben Tages saßt ihr in dieser Bar und spracht über die Ungewissheit des Morgigen. Sie wollte die Bühnen der Kunst erobern und du, du hast unmenschliche Ansprüche gestellt, indem du deiner Naivität nachgabst. Da ihr beide viel wolltet, vielleicht zu viel, vermischte sich diese Ungewissheit mit einer Begeisterung, die Revolutionäre spüren müssen, wenn sie die rote Fahne in die Luft heben. Ihr wart großmütig und das gefiel euch, da der Großmut eure Herzen lüftete. So konntet ihr tiefer atmen und euren Durst nach Welt steigern. Später, es war schon Nacht und die Bar hatte bereits geschlossen, lagt ihr am Strand. Der Strand war kalt, aber der Alkohol in euren Körpern machte euch widerständig. Das Salz des Mittelmeers wusch derweilen eure Füße. Als ihr für einen Augenblick geschwiegen hattet, die Milchstraße hinter den Sternen ahnend, die über den schwarzen Wassermassen blinzten, spürtest du eine Hand auf deiner. Du wandtest deinen Blick nach ihr und die halb über ihren Augen gestrickten Gardinen, ihre Lider, verrieten dir ein Geheimnis, das du mit jenem Foto in der Bar eingefangen hattest. Dem Geheimnis gabst du einen Namen. Das nanntest du Vertrauen.
Zwischen all den Bilderrahmen an der Wand hattest du am selben oder einem anderen Tag noch einen abgehangen, auf dem ein Mann zu sehen war. Das warst du. Du stehst auf einer Treppenstufe und trägst einen dunkelgrauen Anzug mit weißem Hemd und Bordeaux-Krawatte. Du siehst lächerlich aus, besonders dein Grinsen, aus dem deine Schneidezähne kriechen. Hinter dir ist eine breite Glastür. Es ist die Eingangstür der Universität, wo du studiert hast. In deiner Hand befindet sich ein Stück Papier. Du hältst es in einer Art, wie ein Demonstrant sein Schild in den Händen hat, um eine Botschaft in die Öffentlichkeit zu tragen. Deine Botschaft ist, dass du dein Examen erfolgreich abgeschlossen hast, was niemanden interessiert. Aber dein Gesicht verrät, dass es die ganze Welt etwas angehen müsste. Nichts sieht lächerlicher aus, als ein Gesicht, das mit Stolz bekleidet ist. Denn es paktiert mit dem Unehrlichen. Für diesen Tag hattest du lange hingearbeitet. Es war der Tag, an dem du ein Fetzen Papier erhieltst, der mit einem Knopfdruck aus der schmalen Öffnung eines Druckers herauskrabbelt. Die in deinen Schädel gefallenen Wangen und deine Haut überraschen dich. Mit der Zeit ging die Blässe der Bücherseiten nämlich auf deine Haut über, da du hunderte Stunden in Bibliotheken verbrachtest, verbringen musstest. Immer öfter kam es vor, dass du Einladungen alter Freunde absagen musstest, da dein Körper die Wochenenden brauchte, um die Kraft zu sammeln, die die Werktage erfordert hatten. So standst du oft am Scheideweg vor zwei Türen, die eine herkünftige, alte und eine andere, neue Welt voneinander trennten. Du entschiedst dich für die zweite und verrietst die erste. So verabschiedete sich im Stillen ein alter Freund nach dem anderen, bis nur noch ein paar wenige blieben, die sich letztlich auch verabschiedeten. Nur eine Person war schließlich da, nämlich die, die dieses Foto geschossen hatte. Ohne sie, hättest du versagt. Sie hatte dich nicht verlassen. Sie stand neben dir und wenn es sein musste, stellte sie sich hinter dich, damit du nicht fällst, weder auf den Rücken noch auf die Knie. Das hattet ihr einander versprochen. Das nanntest du Loyalität.
Als du dir dieses Foto noch einmal anschautest, aus dem dein Grinsen wie eine Spinne heraussprang, hast du den Bilderrahmen in einem Anfall von Wut gegen die Wand geworfen. Das Glas zersprang und unter den Splittern liegt nun dieses Foto, das du als Schmach und Betrug empfindest. Seither hast du es nicht aufgehoben oder die Glassplitter zusammengefegt. Überhaupt hast du nichts gemacht, außer auf der Matratze zu liegen, aus den Fenstern zu schauen und Zigaretten zu rauchen. Vielleicht warst du dann und wann mal draußen. Dann erschienen dir die Menschen wie durch Straßen wandelnde Torsos, gesichts- und lautlos. Sie spukten durch die Stadt. Du sahst Autos an dir vorbeirauschen, aber sie machten keinen Lärm. Oder warst du taub? Es herrschte absolute Stille, da sich überall um dich herum das absolute Nichts weidete. Ganz inwendig gingst du wie eine ausgestoßene Krähe durch die Straßen, bis du wieder in den vier Wänden warst, wo du dich für eine freiwillige Gefangenschaft entschieden hast. Die Welt, da draußen, eine gefangene, was mit ihr in einem Monat oder in einem Jahr werden sollte, spielte sich hier bei dir ab.
Immer wieder drehst du deinen Blick aus deinem Genick und lässt ihn durch das Zimmer segeln. Allem, jedem Gegenstand, selbst der Decke, dem Boden und den Wänden, haftet ein Stück deiner Existenz an, von der du weißt, dass es nur eine Frage von Stunden ist, dass diese Existenz zerbrechen wird, sobald die Gegenstände, die dir und ihr gehören, getrennt und weggetragen werden. Was Eins aus Zwei wurde, wird wieder Zwei werden, ohne wieder Eins werden zu können. Du ahnst, dass auf diese Existenz ein Nichts folgen könnte, was dich beängstigt. So schließt du deine Augen und reißt dein Herz wie ein Kissen auf und wirfst die Federn um dich, damit du dich im Regen der Federn vergewissern kannst, wer du warst und wer du nicht mehr sein wirst.
Dann klingelt die Tür. Für einen Augenblick ergreift dich eine Ungeduld, die deinen Puls steigert. Sie kann es nicht sein, das weißt du, sie kommt erst morgen in der Frühe. Also stehst du auf und öffnest die Tür. Ein Freund, der für dich da sein will, tritt ein.
Er schaut sich um und sagt, dass er dir helfen will, die Kartons zu packen.
Du lehnst ab.
Er wird unruhig und fragt dich, ob du was isst.
Du bejahst.
Er glaubt dir nicht. Das verrät sein Nicken. Dann fragt er dich, warum du dich quälst.
Du antwortest, dass du dich nicht quälst.
Er sagt, dein Zimmer in der Wohnung sei fertig, du könntest es beziehen.
Du sagst, dass du das tun wirst.
Er sagt, wann.
Du sagst, bald.
Er sagt, du musst sie vergessen.
Du sagst, dass du es nicht musst, da das Vergessen stärker ist.
Er sagt, was machst du dann noch hier.
Du sagst, daran arbeiten, dass das Vergessen es nicht leicht haben soll.
Er lacht.
Du lachst nicht.
Er sagt, sei vernünftig, seit einem Monat bist du hier und lebst wie in einem Fotoalbum.
Du sagst – aber du kannst nichts sagen und verstummst.
Er merkt es dir an. Dann sagt er, lass uns deine Sachen packen.
Du rührst dich nicht.
Er wiederholt sich.
Du rührst dich nicht.
Er wiederholt sich, diesmal schroffer.
Du rührst dich nicht.
Dann geht er.
Nun bist du wieder allein. Du hast dich nicht gerührt, weil ein Klumpen deinen Hals verstopfte. Dir ging es darum ihn zu verbergen, aus falscher Stärke. Der Freund versteht dich nicht, aber du verlangst auch nicht, dass er dich versteht. Es gibt Kämpfe, die kann man nur alleine führen, da bei ihnen kein Sieg, sondern nur Niederlage möglich ist. Inmitten dieser Kämpfe vergeht die Nacht, in der du immer und immer wieder aufwachst und durch das Zimmer patrouillierst wie ein guter Soldat, der Befehlen Folge leistet und Landesgrenzen schützt. Dabei lässt du deinen Blick an diesem oder jenem Gegenstand haften, ohne auch nur die geringste Rücksicht mit dir zu haben. Du fragst dich, warum all das? Weil du weißt, dass du schon morgen ein anderer sein könntest; nein, sein wirst, der die Fülle des Lebens, die du mit ihr erreicht hast, zu einer armseligen Erinnerung herabdrücken könnte, die dir entgegenscheint, wenn er in ferner Zukunft an sie denkt. Du bist hier, in diesen vier Wänden, weil ihr hier etwas aufgebaut habt, das untergehen wird, und ehe es untergeht, willst du es mit einem Brandeisen in deine Seele drücken. Denn schon morgen wird es verschwunden sein und das Einzige, was du retten kannst, ist die Bedeutung, die es für dich hatte. Wer bist du schon, ohne deine Geschichte?
Am nächsten Morgen empfindest du eine Bedrohung. Du verlässt die Wohnung. Du ziehst durch die Stadt und findest einen Bäcker, wo du einen Kaffee trinkst und eine Zigarette rauchst. Dann ziehst du weiter durch die Stadt. Die Zeit beginnt sich allmählich wieder aus der Höhle zu tasten und trennt sich zaghaft vom Raum, neben dem sie wieder zu stehen versucht, Raum-Zeit. Wahllos biegst du ab, beobachtest die müden Menschenkörper, die vom Hauptbahnhof aufgesogen werden und zur Arbeit fahren, wo sie sich selbst vergessen sollen. Nun sind sie keine Torsos mehr, aber haben auch noch keine richtigen Gesichter. Ihnen fehlen, wie dir scheint, die Blicke – das, was Menschen erkennbar macht. Du bist noch nicht soweit. Aber du beginnst ein leises Piepen zu hören, wenn Autos an dir vorbeifahren. Die aufwachenden Spuren des Alltags ängstigen dich, weißt du doch, dass der Alltag das Medium der Gewöhnung ist und weißt darüber hinaus, dass Gewöhnung der Anfang aller Unbewusstheit ist. Du schaust auf die Bahnhofsuhr. Der Zeiger bewegt sich. Das ernüchtert dich, da dich die verdrängte Wahrheit beschleicht, dass die Zeit gegen dich arbeitet.
Irgendwann machst du dich auf in ein Zuhause, das deine Gegenstände verwahrt. Sie muss inzwischen fertig sein. Du hast extra eine Stunde länger als abgesprochen gewartet, damit du sichergehen kannst. Als du der Kreuzung entgegengehst, an der auf der linken Abbiegung das Zuhause liegt, fährt ein weißer Transporter aus der Straße heraus. Während der Transporter links abbiegt und du von rechts kommst, siehst du für einen Augenblick das letzte Mal jenes Gesicht von der Seite, dass dir gelehrt hat, was du Geborgenheit, Vertrauen und Loyalität nennst. Im nächsten Augenblick ist dieses Gesicht, das dich nicht gesehen hat, im Chaos der Welt verschwunden. Du erhebst keinen Vorwurf, nein, sie ist, die sie ist. Du erschreckst nur darüber, dass das, was sie war, in ihr ist.
Mit Blei um den Knöcheln steigst du die Treppen auf, öffnest dir Tür und bemerkst, dass das Zuhause aufgehört hat, ein Zuhause zu sein. Du gehst ins Wohnzimmer. Die Bücherschränke sind halb leer. Die Bilderrahmen sind größtenteils weg. Die Couch ist weg. Die Schränke in der Küche sind offen. Die Matratze, auf der du dich mit samtener Leere bedeckt hattest, ist an die Wand gelehnt. Der Boden ist gefegt und die Glassplitter des Bilderrahmens sind auch weg. Der Bilderrahmen liegt auf der Fensterbank. Das Foto von dir ist nicht mehr drin. Es ist auch weg. Sie hat es mitgenommen, was dich kurz Lächeln macht. Während du den Bilderrahmen noch in Händen hältst, schaust du dich um und siehst, dass der Bagger des Vergessens das Fotoalbum verwüstet und zertrümmert hat. Nun ist es vorbei und du bist bereit. Du hörst auf, Du zu sein. Ich setze ein Fuß aus dem Fotoalbum.

Mesut Bayraktar, geb. 1990 in Wuppertal, gründete »nous – konfrontative Literatur« 2013 gemeinsam mit Kamil Tybel. Er hat Rechtswissenschaften und Philosophie in Düsseldorf, Lausanne, Köln und Stuttgart studiert. Er ist Autor der Romane »Briefe aus Istanbul« (Dialog-Edition, 2018), »Wunsch der Verwüstlichen« (Autumnus Verlag, 2021) und »Aydin – Erinnerung an ein verweigertes Leben« (Unrast Verlag, 2021) sowie eines Buchs über G.W.F. Hegel mit dem Titel »Der Pöbel und die Freiheit« (Papyrossa Verlag, 2021). Auch erschien sein Theaterstück »Die Belagerten« als Buch (Dialog-Edition, 2018), das 2020 in türkischer Übersetzung mit dem Titel »Kuşatılmışlar« durch Tayfun Demir veröffentlicht wurde. 2019 hat er vom Theater tri-bühne seinen ersten Stückauftrag zum Thema Gerda Taro und der spanische Bürgerkrieg erhalten. Der Text wurde fertiggestellt, die Uraufführung Anfang 2020 fiel jedoch aufgrund der Corona-Pandemie aus. Im Rahmen des Projekts »Fehlt Ihnen / Dir Schiller« des Deutschen Literaturarchivs Marbach im Sommer 2021 wurde er als Stipendiat durch den Projektpaten Burkhard C. Kosminski (Intendant des Staatstheaters Stuttgart Schauspiel) ausgewählt. Sein Theaterstück »Gastarbeiter-Monologe« wurde als Szenische Einrichtung (Michael Weber) am 25. November 2021 am Deutschen SchauSpielHaus Hamburg uraufgeführt. Aufführungen in Hanau, Berlin, Bochum, Köln u.a. folgen. Er ist Stipendiat der Kunststiftung Baden-Württemberg in der Sparte Literatur 2019.