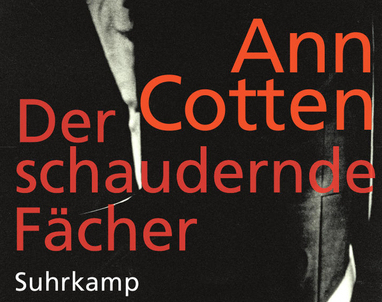von Tabea Krauß
Dieses Buch sei eine Zumutung, schreibt Ijoma Mangold in der ZEIT. Schwer verständlich, fast unlesbar, die Lektüre sei kein Spaß. Mangold hat recht, der Band ist eine Zumutung, aber eine, die grandios gelungen ist, eine lohnenswerte Zumutung.
Ann Cotten, als Lyrikerin bekannt, hat einen Erzählband geschrieben, mit 18 Stücken, die trotz der Verwendung vollständiger Sätze so kryptisch sind wie ihre Gedichte. Bereits die Titel der Erzählungen klingen metaphorisch-rätselhaft: „Talgblasen“, „falscher Jasmin“, „Seekühe der Kunst“ „Huligan“ oder „Le bougie de Wuki“. Cotten sagt, sie habe die Prosaform gewählt, um verständlicher zu werden. Das gelingt ihr kaum. Dafür sind die Geschichten so verdichtet wie Lyrik, intensiv und assoziativ. Man muss langsam lesen und behutsam, sie lassen sich genießen wie Gedichte, jeder Satz will ausgekostet werden.
Cottens Geschichten spielen an den unterschiedlichsten Orten: in Berlin, der Wahlheimat der in Iowa geborenen und in Österreich aufgewachsenen Autorin, in Japan, in der algerischen Wüste und im Kaukasus. Auch wenn jede Geschichte für sich steht, sind die einzelnen Texte nicht völlig unabhängig voneinander. Schauplätze und Personal wiederholen sich, vorallem aber gibt es eine wiedererkennbare Ich-Erzählerin, aus deren Perspektive ein Großteil der Geschichten geschrieben ist.
Diese Ich-Erzählerin tut in der Hauptsache etwas, das in der Literaturgeschichte meist den Männern vorbehalten geblieben ist: sie begehrt. Sie will nicht begehrt werden, das ist ihr geradewegs zuwider oder langweilt sie bestenfalls. Sie begehrt Männer, Frauen, Transen, manchmal auch nur ein abstraktes Konzept von Schönheit. Männer jedoch, heißen in Cottens Erzählungen nicht „Männer“, sondern Jünglinge, Knaben, Berliner Jungs.
Das Begehren ist eine Gratwanderung zwischen machtvollem Blick, Aneignung des Anderen und Demütigung durch den Anderen. Diese Gratwanderung weiß Cotten mit subtiler Grausamkeit zu schildern. In der Erzählung „Huligan“ zum Beispiel bahnt sich die Protagonistin in einem winterlichen Berlin ihren Weg durch einen Pulk von Jungs, anziehend in ihrer jugendlichen Unbekümmertheit und naiven Eitelkeit. Da ist die Faszination am Gedanken des Inakzeptablen, Perversen, die sie, ohne eigentliche Notwendigkeit, geradewegs in diese Gruppe hineintreibt, die Blicke der Jungen auf sich spürend: „Und ich gehe, gehe gerade, die Straße lang, umweht von den Stimmfetzen, die sie mir um die Ohren knattern lassen wie unabsichtlich […]. Sie merken, merken genau. Was hält sie davon ab, mich aufzugreifen und zu zerreißen aus Rache für die unheimlichen, unmöglichen Gedanken, die ich verströme?“ Ann Cotten reicht es nicht, diese Gedanken Gedanken sein zu lassen, sie treibt ihre Protagonistin einen Schritt weiter: Ein Junge trifft sie mit dem Schneeball, auf seine allzu höfliche Entschuldigung drückt sie ihn in den Schnee, kurz darauf wälzen sie sich in einem Hinterhof, der Junge knöpft ihre Bluse auf, die anderen Jungen stehen herum, hin und hergerissen zwischen Spott und Begehren.
Schwer lesbar sind die Geschichten, weil es kaum äußere Handlung gibt. Jeder Ansatz äußerer und innerer Handlung wird durch einen Gedankenstrom begleitet, der sie überlagert und das Geschehen zersetzt. Man muss zweimal lesen um aus der Sprache einen Inhalt zu extrahieren. Die Vergleiche seien „vorsätzlich schief“, schreibt Ijoma Mangold. Sie mögen konstruiert und manieriert sein, aber schief sind sie in der allermeisten Fällen nicht. Ganz im Gegenteil, beim zweiten Lesen, wenn man über die Bedeutung der einzelnen Wörter, die aufgrund ihrer Bildhaftigkeit zunächst keinen Sinn ergeben, hinauszudenken vermag, erscheint das, was sich aus den Sprachbildern herausschält, schärfer, klarer und intensiver als es durch die konventionelle Begrifflichkeit beschrieben werden könnte. So zum Beispiel wenn das Hadern mit einer Entscheidung, die nur mit halber Überzeugung getroffen wurde, gleichgesetzt wird mit dem Schwanken einer Person, die man auf einem Fahrradgepäckträger mitnimmt: „Sie machte kehrt und fuhr mit dem Entschluss zurück, der wackelte, aber nicht fiel. Als hätte sie jemanden aufs Rad genommen“. Oder wenn die Erzählerin für eine eigene, willentlich ausgeführte Geste das Bild von Naturgewalten wählt: „Ich wende seinen Kopf nach vorn und streiche die Haare zurück, als wäre ich Wasser oder ein kühler Wind […]“. Nicht trotz, sondern gerade wegen der Seltsamkeit der Sprache kann die Lektüre sehr wohl auch Spaß machen. Der Wechsel von mit allerhand altmodischen Wendungen durchsetzter Intellektuellen-Sprache und lakonischem Pop-Sprech lässt einen hin und wieder unwillkürlich auflachen.
Die einzigen überflüssigen Stellen sind diejenigen, in denen die Erzählende, die dann auch eine Schreibende ist, sich selbst reflektiert, übers Schreiben nachdenkt. Die Erzählerin versucht dann ein mögliches Urteil über die absurden Assoziationen und die abwegigen Sprachbilder vorauszunehmen und fragt selbst: „Merkt man an den zwischen den verschiedenen Ebenen so hemmungslos verschalteten Argumentationsketten meinen Kater?“ oder „Wer braucht solche Metaphern?“ Diese Selbstreflexion ist unnötig, fast störend. Der Text ist wunderschön in seiner sprachlichen Wirrnis, jedoch nur, solange er sie nicht selbst in Frage stellt, schon gar nicht mit Koketterie.
In der Erzählung „Le bougie de Wuki“ beschreibt die Erzählerin, wie sich ihr Gesprächs- und voraussichtlicher Sexualpartner langsam entspannt, mit dem Bild seines Gehirns, das sich löst wie eine „Blüte in warmem Wasser “. Das Gehirn vollführe nun „zierliche Arabesken, müßig, flüssig bewegt wie Algen in einem dieser mehrdeutigen Berliner Kanalgewässer“. Vielleicht trifft das auch auf die Denk- und Schreibweise der Autorin selbst zu: kunstvoll und verschlungen wie Arabesken, beweglich wie bei leichter Strömung im seichten Wasser schlingernde Algen, dabei undurchschaubar und abgründig wie Berliner Kanalgewässer in der Dämmerung.
Ann Cotten: Der schaudernde Fächer
Suhrkamp 2013
251 Seiten