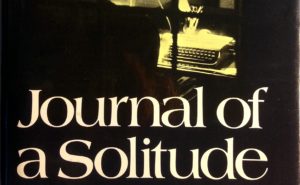von Lucy Fricke
Ein gewöhnlicher Tag im März, es schneit, der Nahverkehr streikt, draußen tobt eine der größten Finanzkrisen der letzten Jahrzehnte, die Milchpreise sind um 20 Prozent gestiegen, die Gaspreise um 30, ich habe Ausschlag von der neuen Nachtcreme und die Taxizentrale sagt, es würde vierzig Minuten dauern bis ein Wagen bei mir wäre. Ich erleide einen Anfall, wie ich ihn in letzter Zeit häufiger habe, irgendwo zwischen Jammern und Fluchen, wiederholt höre ich mich schreien: Mein Flug geht in einer Stunde! Ich brülle etwas von Unverschämtheit, von Dilletantismus, Versager, Penner, Nichtsnutze schreie ich und noch etwas, das sich auf den Untergang dieses ganzen Scheißsystems bezieht, nur weil ein paar Hornochsen jetzt, ausgerechnet jetzt mehr Geld haben wollen. Aus dem Hörer erklingt ein Tuten. Nerven wie Zahnseide, denke ich und halte meine Nase über eine kleine Schale mit Zeug, die mir meine Nachbarin letzte Woche schenkte. Das Zeug in der Schale sieht aus wie mein voller Aschenbecher, besteht aber aus getrockneten Orangenschalen, Salbeiblättern, Lavendel und weiteren Geheimingredienzien, Gelassenheit nannte meine Nachbarin dieses Gebrösel. Ich atme tief ein, man muss nur daran glauben, nur daran glauben, ich atme immer noch ein, Gelassenheit, ich atme aus, ich atme sehr lange aus. Ich wähle die Nummer eines anderen Taxiunternehmens. Eine knappe Stunde, sagt die Frau am anderen Ende. Ich atme ein. Ich erkläre ihr, ganz ruhig, die Situation und dass ich weiß, ich hätte gestern bereits ein Taxi bestellen sollen, das weiß ich doch, trotzdem habe ich es nicht getan, und heute nützt mir das gar nichts. Ich biete den doppelten Preis, sie sagt: einen Moment bitte, ich höre sie flüstern mit anderen, sie spricht wieder in das Mikro: In fünf Minuten wird ein Wagen bei Ihnen sein, und ich frage sie nach ihrem Namen und verspreche Blumen zu schicken.Es dauert nicht fünf, es dauert drei Minuten, ich greife meine Tasche, die immerhin hatte ich gestern schon gepackt, bevor ich noch auf ein Getränk in die Bar bin, wo ich schließlich morgens um sechs immer noch saß und hinter heruntergelassenen Rollläden mit dem Barmann heimlich rauchte, eine Beschäftigung die seit kurzem ähnlich geächtet war wie öffentliches Onanieren. Hätte ich vor lauter Begeisterung dazu nicht ganz so viel getrunken, wäre ich jetzt wohl in besserer Verfassung, aber auch das lässt sich nicht mehr ändern. Ich werfe mich mehr auf die Rückbank, als dass ich einsteige, ich sage: Tegel: ich sage: Linie, Terminal 3, ich sage: die Zeit rennt. Der Fahrer flucht. Auf dem Fetzen Papier, der heutzutage das Ticket sein soll, ist ein frischer Kaffeefleck und die Möglichkeit erwähnt mit dem Handy einzuchecken. Zehn Minuten lang tippe ich Zahlenkombinationen, Flugnummern, Namen in das Telefon, dann habe ich einen Fensterplatz in der neunten Reihe bekommen. Ich lehne mich zurück und der Fahrer hupt sich den Weg frei. Quietschende Reifen in der Haltebucht und schon rase ich durch den Terminal bis zur Sicherheitskontrolle, wo ich den Beutel mit den kleinen Fläschchen heraus hole, keines größer als 100ml, alles abgefüllt, umgefüllt, Duschgel, Shampoo, Lotion, mein Kontaktlinsenreiniger gilt nach neuesten Bestimmungen als Medikament, was in Ordnung geht, schließlich ist Kurzsichtigkeit einen amtliche Behinderung. In den nächsten Kasten werfe ich meinen Laptop, dann Jacke, Schal und Mütze, einen Gürtel trage ich nicht, beim Fliegen nie, auch ansonsten nirgendwo Metall am Körper. Durch die Lautsprecher dringt der letzte Aufruf für Passagiere des Fluges Berlin-Warschau, ich halte meinen Pass aufgeklappt in der Hand und sofort schließen sich die Türen des Shuttle-Busses hinter mir.
Die Maschine landet mit einer halben Stunde Verspätung, ich verpasse die Dämmerung und lande in einem kühlen, verwischten Abend. Eine feuchte Kälte hängt über dem Rollfeld, der erste Eindruck dieser Stadt ist der eines alten Wischlappens, der zum Trocknen im Regen hängt.
Nach ungezählten Monaten bin ich das ewige Reisen leid, als würde der Boden mit jedem Ausstieg aus einer Bahn oder einem Flugzeug weicher werden, als drohe der Boden sich aufzulösen unter meinen Schritten, vielleicht bin auch ich es, dich sich langsam auflöst so genau kann ich das nicht sagen, nur das alles dünn wird, durchlässig, weich, als sei alles nur noch ein einziges Torkeln. All das ist einem Buch anzulasten, welches ich verfasst habe und in dem es, grob gesagt, um Würde und Armut geht, ein Thema, um das sich Hauptstädte regelrecht reißen, wie ich schon sehr bald nach der Veröffentlichung zu spüren bekam. Es ist eine spezielle Ironie dabei, dass sich Bücher über Armut verteufelt gut verkaufen und ich seit einem knappen Jahr ausgebucht bin, mich von Stadt zu Land fliegen lasse, wo ich ausnahmslos in gepflegten Hotels und Restaurants einkehre. Ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal einen öffentlichen Bus genommen habe, genauso wenig wie ich weiß, was man mittlerweile für einen Liter fettarme Milch bezahlt. Unter moralischen Gesichtspunkten ist es eine Unverschämtheit, dass man mir jetzt für dieses Buch einen Preis verleihen will, der mit 20.000€ dotiert ist. Ich habe mich bei Leuten informiert, die Erfahrung damit haben, und die Meinung war einhellig: bei 20.000 musst du hinfahren, bei 20.000 musst du nicht nur hinfahren, du musst eine Rede halten, wären es 10.000 gewesen hätte ich vielleicht zuhause bleiben, ein paar Dankesworte zu Papier bringen und die Kontonummer mitschicken können, aber so hatte ich keine Wahl. Zumal nicht damit zu rechnen war, dass meine Popularität auf diesem Level bleiben würde, ich habe einfach einen Lauf gerade, meinen allerersten und vielleicht allerletzten und wenn man diesen Lauf hat, wenn das deine Welle ist, dann musst du sie reiten. Ich habe nicht mehr die Zeit mit einem Joint am Strand zu sitzen und auf die nächste Gelegenheit zu warten, mit Ende Dreißig wird selbst das Meer ruhiger.
Mit meinem Handgepäck laufe ich durch Hallen, ein paar verstummte Beamte hinter nicht benutzen Schaltern, immer dem grünen Signal folgend, EU-Bürger, keine zollpflichtigen Waren, kein aufgegebenes Gepäck, ich laufe wie am Schnürchen in die Freiheit, lächle einer regelrechten Delegation zu, schüttle Hände und lasse mich auf die Rückbank einer schwarzen Mercedes-Limousine fallen. Es gibt Stimmen, Vorschläge, Pläne, es gibt Reservierungen, Treffen, Attraktionen, es gibt Murren, als ich sage: Ich fühle mich nicht wohl, und Schweigen, als ich beharre, heute Abend nur noch schlafen zu wollen. Es gibt an einer Rezeption die Karte zu einem Zimmer im vierten Stock, es gibt automatisches Licht beim Eintreten, eine Nachricht auf dem Fernsehgerät und Schokoladenherzen auf dem Bett.
Als erstes öffne die Minibar und leere ein zartes Fläschchen Whiskey, wobei ich an der Decke den Rauchmelder entdecke, der auch eine Kamera sein könnte, ein kleines, rotes Licht blickt direkt auf mich hinunter und klebt mir im Gesicht. Auch im Bad haben sie einen montiert. Überall lauern hier kleine, leuchtende Punkte. Fernseher, Safe, Telefon, Türschloss, Steckdose, es ist unmöglich sich in diesem Raum allein zu fühlen, und ich fühle mich gerne allein. Durch das Fenster kann ich nur eine gegenüberliegende graue Wand sehen, wie hingeworfen klebt am oberen Rand ein winziger Glasbaustein in dem Beton. Wenn ich hinunter sehe, endet mein Blick zwei Meter weiter an dem Kühlaggregat der Klimaanlage, den Boden des Hofes sehe ich nicht, der Ausdruck düster wäre für dieses Bild maßlos untertrieben. In meinem Rücken spüre ich weiter die roten Lämpchen, unwillkürlich denke an Lasergewehre und an die Auslöschung jeglicher Existenz. Mir wird klar, dass ich auf keinem guten Weg bin, dass ich dabei bin auf dieser Strecke falsch abzubiegen. Ich blinzle ein paar mal, schüttle heftig meinen Kopf, doch die Enge bleibt, und kurz denke ich: die Rede, ich muss doch die Rede fertig schreiben, dann sehe ich neben den roten auch noch ein paar schwarze Punkte und fast schon in Panik greife ich meine Handtasche und stürme hinaus. Einfach nur laufen, einfach nur ein Stück laufen, ein paar Meter nur, ein bisschen frische Luft und jetzt beginne ich doch zu rennen, renne durch die Straßen, über einen kleinen Platz, über Kreuzungen, durch ein Stück Grün mit leeren Bänken, ich renne bis ich den Fluss erreiche, weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal so gerannt bin. Der Anblick des trüben Wassers beruhigt mich, gekrümmt stehe ich am Ufer, Seitenstiche links und ein rasendes Herz. Ich gehe ein paar Schritte in die Richtung, wo ich das Zentrum vermute, Passanten schauen mich aus den Augenwinkeln an und wieder weg. Ich kann mir vorstellen, wie ich aussehe, ein glühend roter Kopf, Schweiß im Haar, möglicherweise habe ich gar etwas Irres im Blick, das kann ich von hier drinnen nicht beurteilen. Wenn ich nach vorne schaue, sehe ich die Skyline von Warschau, die auch hier nur aus Hochhäusern besteht. Es bleibt die Frage, was ich sonst erwartet habe. Von den Hochhäusern abgesehen ist es dunkel in Warschau. Ich taste mich voran, ohne Ziel und Verstand. Ein Bier könnte helfen, eine Bar, ein Schluck, gesetzte Ruhe, Blicke in Gläser und Welten, ich nehme die erste Kneipe, die sich mir in den Weg stellt, sie ist holzig, sie ist voll, laut und billig. Ein Hocker am Ende des Tresens, ganz allein, abseits vom Gewühl, ich sehe ihn schon vom Eingang aus und kämpfe mich durch. Sitzen hilft, Trinken auch und mehr verlange ich nicht vom diesem Abend. Die Ordnung kehrt schleichend zurück, beim zweiten Bier schneller als beim ersten und beim dritten ist schon fast wieder alles an seinem Platz. Ich verliere mich in fremden Worten und Lauten, nichts ist vertraut und doch alles bekannt. Sprache ist nicht mehr als ein Hilfsmittel. Ich schweige. Die Fremdheit besteht immer zu dreiviertel aus einem Selbst, was nicht zwangsläufig angenehm sein muss. Die Fremdheit ist nah und zu viel. Nach Hause wäre gut, schlafen, aufwachen, liegen bleiben, die ewige Frage, wo das ist, wo das sein soll und zurück zu den Einfachheiten, Zuhause ist da, wo die Post hingeschickt wird, wo man tatsächlich den Briefkasten leert, täglich am besten. Irgendwann muss es genug sein mit den immergleichen Fragen und der nicht endenden Variation von Antworten. Ich hebe meinen Arm mit dem Wunsch nach der Rechnung, greife nach dem Portemonaie und dann ist es passiert, dann ist es weg, alles, dann ist da nichts mehr, nur noch die Blässe in meinem Gesicht und nichts in der Hand. Die Tasche, die eben noch da, die eben noch am Hocker, die eben noch. Nichts.
Ich könnte zapfen, spülen, tanzen. Ich könnte noch mal ganz vorne, könnte illegal in Polen leben, mich verheiraten und Kinder großziehen. Stattdessen Schulterzucken vom Barmann, Kopfschütteln und morgen, morgen ist auch noch ein Tag, morgen kann ich wiederkommen, morgen ist die Rechnung immer noch da und das wird versprochen. Morgen. Und ich werde, ganz sicher werde ich. Das Vertrauen von Barmännern enttäuscht man nicht, niemals und unter keinen Umständen. Einen Barmann zu bescheißen führt direkt in die Hölle, dessen bin ich mir sicher und war das schon immer.
Es wird sich alles klären, alles beheben lassen, es sind nur Karten, es ist nur Geld, es ist nur das Handy, das Blackberry, es sind nur Adressen, Nummern, Identifikationen, Beweise. Das Hotel wird helfen, die Rezeption wird helfen, die Polizei, der Schlaf wird helfen. Ich muss nur hinkommen, nur ein kurzes Stück noch und alles wird nur halb so schlimm sein. Ein Taxi wird helfen, ein Fahrer, der wissen wird, wo ich bin und wo ich hin will. Ein paar Schritte nur und dort stehen die Wagen in Reihe. Wieder die Rückbank, der Ausschnitt eines Gesichtes im Spiegel, wieder die Müdigkeit. Marriott, sage ich, und er fährt los, über Hauptstraßen und Kopfsteinpflaster, Einbahnstraßen, Schleichwege, Schnellstraßen, vorbei an Einkaufszentren, Luxusmeilen, Baugerüsten, Brachanlagen, diese Stadt gleicht einer Wunde, an der die Nähte aufgeplatzt sind, das Innere quillt in alle Richtungen und meine einzige Orientierung ist das Taxameter, welches sich immer, egal wo, bei Ortsfremden vor Freude überschlägt. Es rattert in meinen Ohren, vollkommen unmöglich so weit gelaufen zu sein, ich beginne auf meinem Sitz herumzuzappeln, der Fahrer wirft mir einen Blick zu und nickt freundlich. Wenige Minuten später hält er an, zeigt mit dem ausgestreckten Finger nach rechts und dort steht es, in leuchtenden Buchstaben: Hotel Marriott. Das kann nicht sein, denke ich, und sage das auch, das ist nicht mein Hotel, mein Hotel war kleiner, mein Hotel war älter, mein Hotel war überhaupt ganz woanders. Er zeigt nur weiter mit dem Finger auf das Schild über dem Eingang und Moment, sage ich, ich werde reingehen und das klären. Aber so einfach ist das nicht. Er will sein Geld, er will es jetzt, sofort, gestern am besten, er schreit, ich verstehe kein Wort, trotzdem alles, er hämmert auf seinen Taxameter, schlägt auf das Lenkrad, er brüllt, ich brülle, der Typ ist nicht ganz beisammen, denke ich noch, da steigt er schon aus, läuft um den Wagen herum und zerrt mich am Mantelkragen hinaus. Wir brüllen uns in die Gesichter, bis ich mich losreiße und zum zweiten Mal an diesem Tag beginne ich zu rennen, ich renne und höre wie er in sein Auto springt, das Gaspedal durchdrückt. Dieser Irre rast mir auf dem Bürgersteig hinterher, ich flüchte nach links in eine kleine Straße, in ein Gewirr von Straßen, ich flüchte, ich flüchte tatsächlich denke ich, in meinem ganzen Leben bin ich noch nie geflohen, vor nichts und niemanden. Ich renne, ich renne weiter, links rein, rechts rein, ich stürze in eine Bar, drei Stufen hinab. Alles starrt mich an, wie ich im Türrahmen stehe, um Halt und Luft kämpfend. Ja, mir ist zu helfen, möchte ich sagen, mir wäre unter Umständen zu helfen, wenn es jetzt jemand richtig gut mir meinen würde, dann wäre ich zu retten. Ansonsten verloren, das ahne ich in diesem Moment. Blicke wie schwere Pranken auf den Schultern, es drückt mich nieder, ich taumle auf dem Treppenabsatz ihres Wohnzimmers, jemand ruft mir etwas entgegen, was wohl eine Frage ist und mir versagt die Stimme. Langsam setze ich die Schritte zurück, taste nach dem Ausgang, kein Ort zum Bleiben, ich will nach Hause, einfach nur nach Hause, ich will schlafen. Der Schwindel reicht bis in die Füße. An Hauswänden stütze ich mich ab, Seemannsgang durch fremdes Land.
Meine Erinnerung ist nicht auf Stand, ich kam mit dem Flugzeug, ich ging in ein Hotel und weiß noch, wie der Ausblick aus meinem Fenster war, ein enges Grau, ich weiß, das Bett stand rechts neben der Tür, das Bad war links, die Minibar neben dem Schreibtisch, das alles weiß ich und es hilft nicht. Wie waren die Namen? Wo waren die Verabredungen, wann waren sie? War mein Hotel vielleicht gar nicht das Marriott sondern doch das Interconti, Sofitel, Radisson, Westin, Hilton, Hyatt?
Welche Nummer hatte meine Kreditkarte? Wie lange ist der Ausweis noch gültig? Wie groß bin ich wirklich? Wann habe ich meine Mutter das letzte Mal gesehen? Ich versuche das Wasser zu finden, Flüsse sind Adern, Flüsse sind immer da, wo sie waren, an Flüssen lässt sich eine Richtung ausmachen. Das wäre hilfreich, eine Richtung, eine Orientierung, etwas an dem man entlang gehen kann. Vielleicht sollte ich zur Polizei gehen, den Diebstahl meiner Handtasche in einer trunkenen Nacht melden, vielleicht sollte ich mir helfen lassen, vielleicht sollte ich mich erinnern, mich endlich erinnern. Einen Schritt vor den anderen, ich schwitze immer noch oder schon wieder, ich höre das Blut in meinem Kopf rauschen, ich höre Kinderschreie von weit her. Irgendetwas ist gerissen, eine Verbindung hat sich gelöst. Das Leben ist nur ein Ort, der auch woanders liegen könnte. Ich wanke die Hauptstraße hinunter. Die Stadt ist grob, sechs Spuren, schmale Gehwege, Häuser, die sich neigen und nirgendwo Bewohner. Wie spät mag es sein? Wo ist Norden? Wo ist die Mitte, wo der Fluss? Und wo, wo ist das Hotel? Als ich einen kleinen Platz erreiche, knicken mir die Beine weg, als hätten sich die Muskeln aufgelöst in Sekundenschnelle, jetzt also auch noch die Beine und dann sacke ich zusammen auf einer kleinen, frisch gestrichenen Bank. Grün ist die Farbe und noch feucht. Ich strecke mich aus, lege mir die Hände unter den Kopf, ich friere, ich schwitze, schließe die Augen. Ruhig ist es, sehr ruhig und der letzte Satz, bevor ich verschwinde: Ich ist auch nur ein Name.

Lucy Fricke wurde 1974 in Hamburg geboren, sie hat an zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mitgearbeitet, bevor sie 2003 ihr Studium am Literaturinstitut Leipzig begann. 2005 gewann sie den „open mike” der Literaturwerkstatt Berlin, der als wichtigster Preis für Nachwuchsautoren gilt. Ihr Debütroman “Durst ist schlimmer als Heimweh” erschien zwei Jahre später im Piper Verlag. Zur Zeit ist sie Stipendiatin im Künstlerhaus Lukas, Ahrenshoop, wo sie an ihrem zweiten Roman und einem Drehbuch arbeitet.