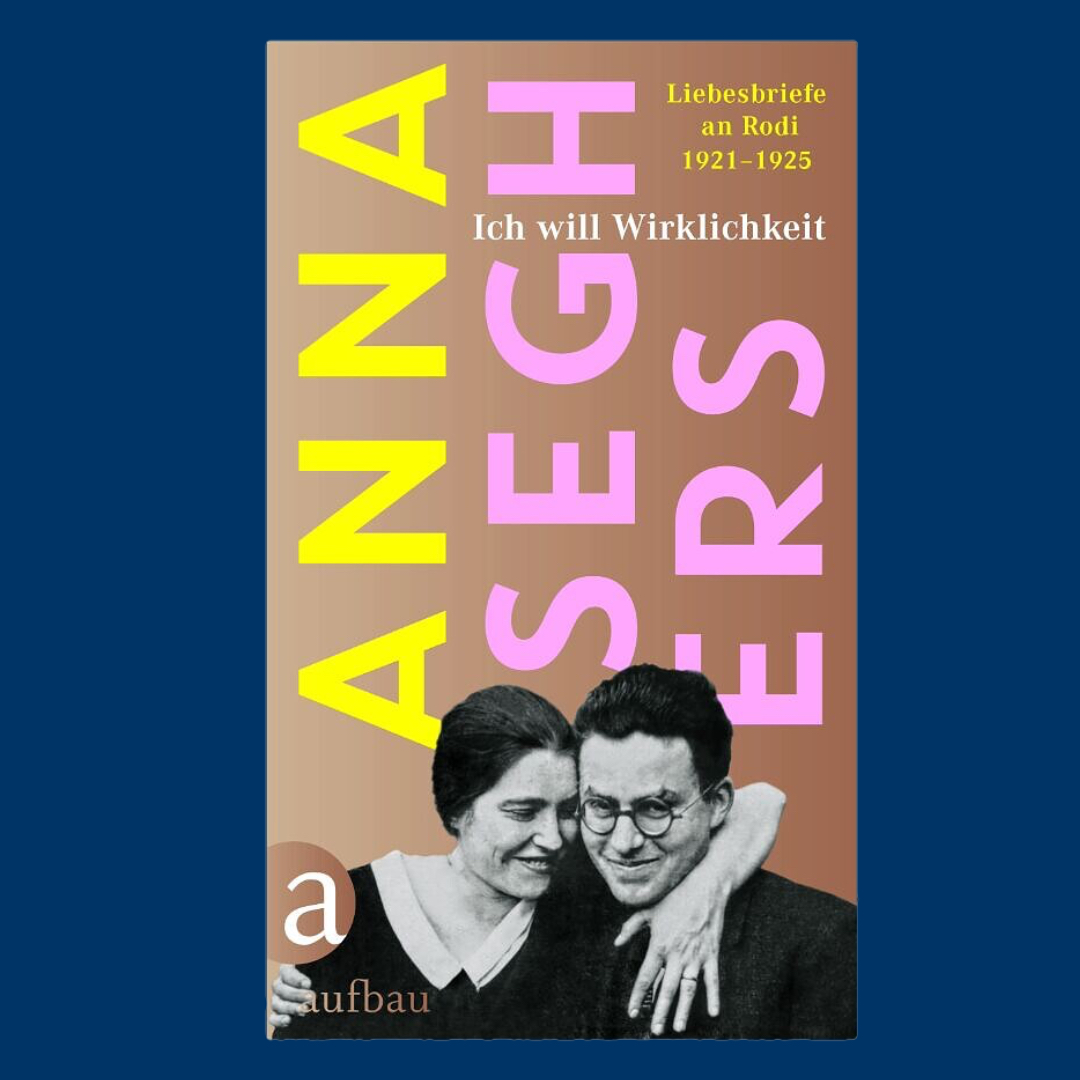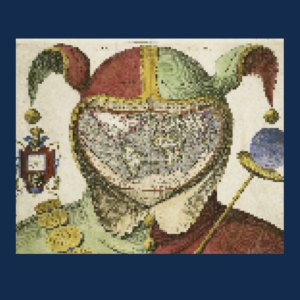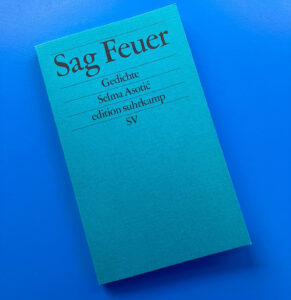© Aufbau Verlage
von Josipa Grubeša
Am 19. November dieses Jahres würde Anna Seghers ihren 125. Geburtstag feiern. Obwohl sie längst nicht mehr unter uns ist (die 1900 geborene Mainzerin ist 1983 in Ost-Berlin gestorben), hat sie uns anlässlich ihres Geburtstags ein Überraschungsgeschenk hinterlassen: über 400 Briefe, einige Fotographien und Zeichnungen aus den Jahren 1921–1925, die ihr Enkel und Verwalter ihres literarischen Erbes Jean Radványi im Familiennachlass gefunden hat. Die Briefe stammen fast ausschließlich von der jungen Studentin Netty Reiling (wie Anna Seghers bis zu ihrer Heirat 1925 hieß) und sind an den gleichaltrigen ungarischen Auslandsstudenten und ihren späteren Ehemann László Radványi adressiert. Netty Reiling lernte ihn an der Universität Heidelberg, wo sie selbst studierte, kennen und in kurzer Zeit ist aus der Bekanntschaft eine Freundschaft und Liebesbeziehung entstanden. Diese wurde von einem Briefwechsel begleitet, von dem aber nur die Briefe Anna Seghers erhalten geblieben sind.
Die Briefe überraschen in vielerlei Hinsicht und erhellen zugleich eine wichtige Phase im Leben der berühmten Literatin. Die Rolle des Judentums im Leben der jungen Seghers, die in der DDR nach ihrer Rückkehr aus dem mexikanischen Exil häufig heruntergespielt wurde, wird vielleicht am meisten verwundern. Ihr Wunsch, das Hebräische wieder so gut zu können, wie sie es in der Kindheit konnte, die Überlegungen, am Zionistenkongress in Wiesbaden teilzunehmen oder auch das Thema ihrer Doktorarbeit, nämlich „Jude und Judentum im Werk Rembrandts“, zeugen davon, dass das religiöse Elternhaus einen nachhaltigen Einfluss auf die junge Doktorandin der Kunstgeschichte ausgeübt hat.
Als zweite große Überraschung wird auch ihre Einstellung und ihr Verhältnis zum Kommunismus erscheinen. Obwohl ihre Abscheu gegenüber der spießigen bürgerlichen Gesellschaft, in die sie hineingeboren wurde, in vielen ihrer Briefe sehr deutlich zum Ausdruck kommt, ist die junge Seghers noch bei Weitem nicht die überzeugte Kommunistin, die sie nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geworden ist. Die spätere Funktionärin der Kommunistischen Partei und Präsidentin des Schriftstellerverbands der DDR äußert sich in ihren Briefen ausgesprochen misstrauisch gegenüber der KPD:
„In Deinem Kopf u Deinem Herzen ist ‚Partei‘ ein großes Wort, aber ich verstehe nichts davon u es ist mir bloß ein großes großes Tier mit bösen Augen, wovor ich Furcht habe. Möglich daß ich eines Tages das alles sehr gut verstehe.“ (22. Februar 1925)
Immer wieder bittet sie ihren „Rodi“, sich vor ihrer Heirat nicht politisch zu exponieren, um sie auf diese Weise nicht zu vereiteln.
Von Heirat ist im Briefwechsel schon sehr früh die Rede (sogar in einigen Briefen von 1921) und dies ist auch das eigentliche Thema dieses Briefwechsels: Liebe. Ja, in der Tat geht es die ganze Zeit um Liebe und nicht etwa um Verliebtsein, wie das bei einem so jungen Menschen vielleicht zu erwarten wäre. Denn Netty Reiling ist keinesfalls eine naive Studentin, die eine rosarote Brille trägt und ihren Geliebten idealisiert. Mangelhafte Deutschkenntnisse, schlechte Körperhaltung, träge Job- und Wohnungssuche sind nur einige Themengebiete, in denen der junge ungarische Philosophiestudent von seiner Freundin klar und deutlich kritisiert wird.
Diese Kritiken sind aber immer von viel Liebe und Zärtlichkeit durchwoben und das ist das glänzendste Moment dieses Briefwechsels: Das Allgemeine und das Alltägliche werden in einer zärtlichen und liebevollen Sprache, durch eine brillante Eloquenz dargestellt. Es wird getadelt, Fehler werden klar benannt und Missverständnisse auskommuniziert, aber liebevolle Vergewisserung bleibt niemals aus:
„Oh, mein Herz, ich bin betrübt über Dein Versagen im Praktischen. Deine Unzulänglichkeit hierin hat schlimme Folgen u das Schicksal der Seele wird vergewaltigt. Ich bin müde u sowie du weg gehst, beherrschen mich die schrecklichsten Selbstquälereien u garnichts fehlt darin. Von Traumversuchung bis Todesfurcht – u Ahnung. Sobald Du bei mir bist, werde ich ruhiger.“ (4. Juni 1924)
Die Heftigkeit ihrer Liebe äußert sich in den Briefen auch in einfallsreichen Anredeformeln und Kosenamen. „Mein Herz Jesu Kirchlein“ ist sicherlich nicht der seltsamste Spitzname, den man in Netty Reilings Briefen finden kann. Wie wohltuend László Radványi für die junge Seghers ist, sieht man auch daran, dass er immer der erste Leser ihrer literarischen Versuche ist, mit dem sie sich in dieser Hinsicht gerne berät und dessen Meinung sie über alles schätzt. Überhaupt ist Rodi ihre einzige Bezugsperson, der einzige, der sie versteht und nach dem sie sich sehnt. Insbesondere in den Phasen, in denen sie längere Zeit voneinander getrennt sind, wird der Briefwechsel intensiver und Netty schreibt manchmal auch mehrmals an einem Tag.
„Dein Kommen ist etwas anderes als Freude, es bedeutet das einzige Mal, wo ich nicht allein bin, wo ich meine Seele verwerten kann, wo meiner Seele nicht weh getan wird. Du wirst mich verstehen, obwohl alles, was ich Dir davon schreiben kann, zu wenig ausdrückt. […] Ich werde stark sein und für Dich wachsen. (30. Oktober 1921)
Die Sprache der Briefe ist noch in einer weiteren Hinsicht interessant. Die tiefsinnigen Betrachtungen über die Mitmenschen und zahlreiche Beobachtungen und Bemerkungen zu Kunst und Literatur deuten auf die Menschenkennerin und Erzählerin mit der großen poetischen Kraft hin, die Anna Seghers im Laufe der Jahre geworden ist. Wer also Parallelen zu ihrem späteren Oeuvre und vor allem zu ihren Romanen und Erzählungen sucht, wird nicht im Stich gelassen.
Mit einem großen und ausführlichen Anhang, einer begleitenden Zeittafel für die Jahre 1921–1925 und einem aufklärenden Vor- und Nachwort von Jean Radványi sind diese Briefe nicht nur ein wichtiges Dokument für das germanistische Fachpublikum. Sie sind wahrlich ein Fund für alle, die hinter einer literarischen Ikone des 20. Jahrhunderts einen Menschen kennenlernen wollen.
Die Liebesbriefe der jungen Anna Seghers sind unter dem Titel „Ich will Wirklichkeit“ am 11. November 2025 im Aufbau Verlag erschienen.