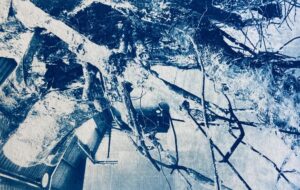von Heidrun Rietzler
Steh auf, los, steh auf!
Jetzt!
Der Wecker spielt dieselbe Melodie bereits zum wiederholten Mal. Morning has broken, ein simples Acoustic Cover für einen simplen Song. Kein Problem, ihn in die Schwärze hinter den Lidern einzuflechten.
Du öffnest dein linkes Auge einen Spalt. Nach der Dunkelheit ist das Sonnenlicht gleißend hell.
Deine Kehle kratzt, du schluckst. Die Zunge hebt und senkt sich, klebrig löst sie sich vom Gaumen. Wasser. Doch die Küche kommt dir meilenweit entfernt vor.
Die Decke liegt schwer auf deinen Gliedern. Lähmend wie die ganze beschissene Welt, die dich mit ihrer Last niederdrückt. Heute ist ein wichtiger Tag – der Tag, um tatsächlich eine Änderung zu erringen. Du musst nur aufstehen, dich hinsetzen und schreiben, dann wäre dein Abschluss in greifbarer Nähe. Aber die Decke … schluckt … alle … Energie.
Los, gib dir einen Ruck, steh auf, steh auf, steh auf!
Du wendest all deine Kraft auf, um die Arme aufzustellen und dich nach oben zu drücken. Dir wird schwindelig und übel,doch du gibst nicht auf, nicht heute. Langsam bewegst du deine starren Beine. Wie ungelenk und fremd sie dir sind. Du nimmst sie in die Hand, hebst sie an und setzt sie auf dem Boden ab. Die Beine in die Hand nehmen. Was für ein idiotischer Ausdruck. Die Beine in die Hand nehmen bedeutet eben nicht loszurennen, in einem Affenzahn, um seine Freiheit zu spüren und alle Hemmnisse hinter sich zu lassen. Die Beine in die Hand nehmen bedeutet, sie tatsächlich zu umklammern, zu heben und in die Position zu bringen, die sie eigentlich von selbst einnehmen sollten. Tun sie aber nicht, schließlich bewegst du dich zu selten, die lähmende Starre deiner Gedanken scheint sich auf deinen ganzen Körper ausgedehnt zu haben.
Du kennst deine Wohnung in und auswendig. 12 Schritte vom Bett zur Couch. 15 Schritte von der Couch zum Küchenstuhl. 8 Schritte vom Küchenstuhl zur Toilette. Die wichtigsten Ruhepole in deinem engen Raum. Aber er gehört dir, dir ganz allein. Er ist deine bedeutendste Errungenschaft auf deinem Weg in die Selbstständigkeit. Du machst dich also auf den Weg.
Eine unheimliche Anziehungskraft geht von der Couch aus. Aber zuerst Wasser. Dann darfst du dich auf die weichen Polster setzen. Ausruhen. Du blickst auf den großen Flachbildschirm. Automatisch schaltest du ihn ein, gehst auf das Streaming Portal. Nicht, weil du etwas sehen willst. Du willst einfach ein Hintergrundgeräusch in deinem Raum. Etwas, das die dröhnende Einsamkeit übertüncht. Etwas, das dich vergessen lässt, in welchen Umständen du hier drinnen haust. Netflix. Das ist das Opium des Volkes, scheiß auf Religion.
Du nippst an deinem Glas. Irgendwelche Aliens wollen wieder Mal die Erde auslöschen, haben aber keine Chance gegen unsere Superhelden. Superhelden. Das waren Mal Comicfiguren mit Superkräften, heute kann das jeder sein: Nachbarn, Kinder, einmal sogar eine Sprachwissenschaftlerin. Allen gemein sind die sinnlosen Dialoge mit dem Daseinszweck, nicht eine Action-Szene nach der anderen aneinanderzureihen oder wenn doch, um wenigstens etwas Humor einzustreuen, der flacher ist als Knock-Knock-Witze. Die Love-Story darf natürlich auch nicht fehlen: Einer der unzähligen Männer fängt etwas mit der einzigen weiblichen Hauptrolle an, Drama oder Happy End, egal, sie ist jedenfalls hin und weg von dem Typen.
Die Sonne blendet, das Fenster spiegelt sich auf dem Bildschirm. Mühsam kommst du zum Stehen. Du könntest das nutzen, zum Schreibtisch gehen und schreiben, doch du schließt nur die Vorhänge. Begleitet von Maschinengewehren und einer verzweifelten Frau, die um ihr verlorenes Kind weint, wankst du in das Badezimmer. 1, 2, 3, … Du schaltest das alte Radio ein, das du aus dem Sperrmüll gezogen hast, Oldies erschallen aus dem Gerät. So ist es doch gleich besser.
Dein Handy sagt, dass du den halben Tag geschafft hast. Kein Anruf, keine Nachricht, nichts. Gut. Du gehst in die Küche. Du kennst die Handgriffe. Box an, irgendein Podcast, Ramen aufkochen. Drogen, Deutschrap, das Übliche. Du spürst wieder Übelkeit in dir hochkommen. Lieber setzen. Du legst den Kopf auf den Küchentisch und wartest, bis dein Essen endlich aufgequollen ist und aus den seltsamen Plastiknudeln eine essbare Pampe wird. Mit dem Essen in der Hand schleppst du dich auf die Couch zurück, wo der Superheld irgendeine geistlose Rede hält. Die Erde braucht uns und so. Dramatische Musik daruntergelegt und alle sind beeindruckt. Du schaltest die Audiospur auf Polnisch, einfach so. Man soll sich schließlich weiterbilden, neue Sprachen lernen. Leider hat jetzt keiner mehr was zu sagen, weil alle damit beschäftigt sind, zu sterben oder zu töten. Dir kommt das Essen hoch. Im Badezimmer übergibst du dich zu Capital Bra, der von der Küche aus gegen Abba ankämpft.
Du zwingst dich zu deiner täglichen Gassi-Runde in der Außenwelt. Kopfhörer auf, Hörbuch an. Du meisterst die unzähligen Treppenstufen des Hausflurs, bis du endlich draußen ankommst. Du wankst über den Teer, Blick gesenkt. Karl May versucht, den Wilden Westen in Besitz zu nehmen, während du versuchst, die letzte Parkbank zu ergattern. Geschafft. Eine Ansammlung von Zigarettenstummeln unter dir, teilweise nur halb geraucht, was für eine Verschwendung. Kinder zerren an den Hosen ihrer Eltern, um Aufmerksamkeit zu bekommen, ihre hohen, schrillen Stimmen dringen trotz deines Abschirmungsversuchs an dein Ohr.
Im nächsten Supermarkt holst du deine Belohnungen. Wein, mehr Ramen. Deine Schätze umarmend, machst du dich auf den Heimweg, May geht dir endgültig auf die Nerven, du bringst ihn zum Schweigen. Die Stille trifft dich hart, trotz der Lärmquellen der Außenwelt. S‑Bahn, zankende Passanten, das langanhaltende Hupen eines Autofahrers, der nun wirklich keine Lust mehr hat, hinter dem langsamen Fahrradfahrer herzurollen. Fast geschafft, da ist schon die Haustür, du schleppst dich über die letzten Meter, bist schließlich da.
Der Schlüssel zur Haustür passt nicht. Oder das Schloss. Schlüssel-Schloss-Prinzip, was auch immer, es funktioniert nicht. Hat es noch nie. Schweißperlen fließen zu deinen Augenbrauen, tropfen von dort aus in die Augen. Es brennt, der Schlüssel erscheint nur noch verschwommen. Du schüttelst den Kopf, um den Schweiß aus den Augen zu bekommen. Schwindel. Schweiß, Schlüssel, Schloss, Scheiße. Du fällst, liegst vor dem Eingang deines Ziels, so nah.
Du öffnest dein linkes Auge einen Spalt. Ein Schleier vor den Augen verhindert die klare Sicht, vermutlich besser so. Geräusche dringen an dein Ohr. Stimmen, so viele Stimmen. Sie sind gekommen, um dich zu holen. Dein linkes Auge ist schon ein Spalt offen. Nein, Fehlalarm. Es geht alles seinen gewohnten Gang, über dich hinweg, um dich herum. Du kannst förmlich deren Gedanken hören: »Bloß nicht hinsehen, ist vermutlich besoffen oder so.« Du schließt die Augen wieder, begrüßt die Schwärze.
Deine Schätze liegen um dich verstreut, der Schlüssel zur Wohnung liegt fest in deiner Hand. Du fischst mit den Füßen nach deiner Habe. Alles da, gut, dass du keine Glasflasche genommen hast. Schweigen um dich rum, alles versucht krampfhaft, dich zu ignorieren. Egal. Du gibst diesen Menschen Namen, Geschichten. Stellst dir vor, wie abgefuckt ihr Privatleben ist, das sie so verzweifelt versuchen, hinter ihrer Kleidung zu verstecken. Es gab Zeiten, da wolltest du Kontakt zu ihnen, hast dich in ihre Mitte gesehnt. Dann wolltest du sie anbrüllen, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Inzwischen lassen sie dich kalt. Du brauchst sie nicht, sie brauchen dich nicht. Du hast alles, was du brauchst, all den Zuspruch, den du brauchst. Du wirst unruhig, du warst zu lang draußen, der Unmittelbarkeit der Welt ausgesetzt. Zeit, wieder zur Ruhe zu kommen, die gewohnten Beschallungen zu erdulden, zu sein. Du stellst dir deinen Platz auf der Couch vor – eingedellt und fleckig – und nutzt die Sehnsucht, um wieder hochzukommen und den Kampf mit der Haustür aufzunehmen. Endlich schaffst du es.
Das Knarzen der Holztreppe im Treppenhaus hat dich schon immer gestört, am schlimmsten ist es, wenn es sich mit dem Quietschen von Hartgummisohlen darauf paart. So wie heute. Du bekommst Kopfschmerzen von dem Gekreische.
Dein Raum umfängt dich, wegen der Vorhänge dunkel und etwas muffig, ein Geräuschchaos aus Radio und Fernsehen, das dich mehr tröstet als jede menschliche Begrüßung. Sicherheit, die durch diesen Kokon aus Dunkelheit, Töne und Stimmen entsteht, die wabert, dich einlullt, dich aufnimmt. Du gehst wie ferngesteuert auf die Couch, Autoplay sorgte für irgendeine neue Serie.
Dir fällt ein, dass heute ja etwas war. Ein wichtiger Tag, der Tag. Welcher Tag? Du weißt den Wochentag nicht, geschweige denn das Datum. Trotzdem. Es nagt an dir, dass du nichts getan hast, die Abschlussarbeit immer noch unbearbeitet in den Untiefen deines PCs ruht. Ein Blick auf die Uhr bestätigt dir, dass es vermutlich schon zu spät ist, heute zu einem lohnenden heute werden zu lassen. Genervt, aber auch etwas erleichtert, nimmst du es hin, trinkst und siehst zu, wie die Welt gerettet wird.

Heidrun Rietzler, geboren 1997, ist begeisterte Vielleserin. Besonders Zwischenräume, ‑töne und Ungereimtheiten faszinieren sie. Ihr Schreiben stellt einen Versuch dar, ein weiteres Echo in diese Grauzonen einzuflechten.