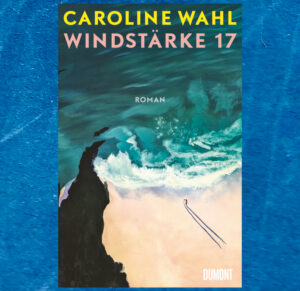von Myriam Kammerlander
Ich merke es an der Uhr. Die alte Ticktackuhr an Omas Wand, die jeden Abend aufgezogen werden muss. Sie ging auf die Minute genau und schlug zuverlässig zu jeder Viertelstunde. Bim bam. Mittags wie mitternachts schlug sie zwölfmal ohne Erbarmen. Zu nachtschlafener Zeit wussten wir genau, wie spät es war.
Nicht so jetzt. Jemand hat die Uhr nicht mehr oder zu spät aufgezogen, und der Mechanismus hat sich davon nicht erholt. Die Uhr tickt und schlägt seither in Anarchie. Viertel vor ist viertel nach, und ständig ist es fünf vor halb. Oma und ihre Uhr leben in einem Dauerzustand der Zeitlosigkeit und schrecken nur auf, wenn wir zu Besuch kommen und fragen: Soll ich mal deine Uhr aufziehen? Wir versuchen die Zeit anzuhalten, indem wir die Uhr nachstellen, aber sie hat ihren eigenen Rhythmus.
Als Kindern war uns die Zeit egal. Wir maßen sie in Sonne, Sand, Seifenblasen.
Omas Uhr hingegen taktete den Tag genau. Sechs Uhr dreißig aufstehen, sieben Uhr Frühstück, danach Hausputz. Mittagessen um halb eins. Opa schnitt am Küchentisch knirschend Chinakohl in filigrane Streifen. Oder es gab Eisbergsalat mit Fertigsoße.
Manchmal überfallen mich aus dem Hinterhalt die Essensgerüche meiner Kindheit. Fischstäbchen, Schlemmerfilet, die ganze Bofrostpalette. Kartoffelbrei dazu. Und der Spinat mit dem Blubb. Oma kochte nicht gern. Aber sie war gut organisiert.
Es gibt noch Blubbspinat in der Tiefkühltruhe, es gibt vorgekochte Mahlzeiten für Monate, doch Oma isst wie ein Vögelchen. Sie mag ihre Suppe nicht aufessen. Nicht mal den Nachtisch. Früher ging immer noch ein Nachtisch rein. Nach Opas Tod überbrückte sie wochenlang mit Nescafé und Schokowaffeln.
Ich habe Oma einen Liegestuhl in den Garten gestellt. Darin sitzt sie schief und krumm, während ich ihr die Haare schneide. Es ist Altweibersommer, ein Wort, das ich von Oma gelernt habe. Wenn die Spinnwebfäden wie silberne Haare durch die Lüfte treiben und alles ist in dieses goldene Licht getaucht, und der Himmel ist blau und wirkt manchmal verwaschen, und morgens liegt Tau.
Oma hat spinnwebfeine Haare und spinnwebfeine Falten, ihre Oberarme zeichnet ein Furchenmuster, die Zeit hat Rinde aus ihrer Haut gemacht. Ihre Augen sind leuchtend blau. Schon immer. Sie sieht mich prüfend an und fragt: Und, verlobt ihr euch mal?
Gleich muss ich zum Zug. Jetzt ist mein Tag getaktet, ich habe immer nur ein paar Stunden für Oma. Darin muss ich alles unterbringen, ich muss zum Friedhof, zur Bank, Rasenmähen, ich muss all die Dinge erledigen, die Oma nicht mehr schafft.
Sie mag es nicht, dass wir uns um sie kümmern müssen. Allein sein mag sie auch nicht. Zur Begrüßung fragt sie: Und wann kommst du wieder? Zum Abschied: Möchtest du dich nicht noch ein wenig in den Liegestuhl setzen? Beim nächsten Mal, sage ich meistens.
Die Ticktackuhr schlägt elf. Es ist vier. Ich kündige schon mal an, dass ich bald los muss, damit Oma später nicht so überrascht davon ist. Nimm dir Äpfel mit, sagt sie, wer soll die denn sonst alle essen? Der Apfelbaum trägt wunderbar, aber man muss die Äpfel essen, sie halten nicht lange.
Und dann fragt Oma: Brauchst du nicht Wäsche? Du kannst dir was aus meinem Kleiderschrank aussuchen. Wirklich?, frage ich. Jaja, sagt Oma, was soll ich denn mit all den Sachen.
Im Schlafzimmer riecht es unbewohnt. Ich streiche über Omas seidenen Bademantel, finde einen dünnen Schlips von Opa, lasse alles, wo es ist. Die Schleifchen und Schatullen, Porzellanfiguren und Perlenketten. Die Fotos meiner Kusinen und mir an den Wänden, mit schiefen Zähnen, Schultüten und Kommunionkerzen. Kunstwerke aus unseren Kindergartenzeiten, sorgfältig aufbewahrt. Die Nachbildung von Dürers betenden Händen, vor der ich als Siebenjährige ehrfürchtig stand. Die Nachttischlampe mit dem gedrechselten Fuß, der Schirm ist voller Fliegendreck. Das Ehebett sieht aus wie frisch bezogen.
In der Nacht, als Opa starb, war das Haus voll. Meine Eltern und Oma wachten unten im Wohnzimmer, um das Pflegebett herum, in dem Opa zwischen geblümten Laken immer weiter schrumpfte. Meine Schwester und ich lagen oben im Bett der Großeltern. Da durften wir als Kinder nur hinein, wenn wir krank waren und uns schnell gesund schlafen sollten.
Gegen drei Uhr morgens schreckte ich angsterfüllt hoch mit dem Gefühl, jemand stünde neben mir. Später dachte ich, ob das wohl der Tod war, der sich in der Etage geirrt hat. Mein Großvater starb kurz darauf, als endlich alle eingenickt waren. Das Pflegebett steht jetzt wieder im Wohnzimmer.
In diesem Sommer muss ich andauernd an diese Zeit denken. Vielleicht weil Oma so deutlich verschwindet. Wir müssen das Haus ausräumen, sagt meine Mutter einmal beiläufig.
Nun stehe ich mittendrin im Sammelsurium eines Lebens und weiß nicht wohin mit mir. Im Wäscheschrank stoße ich auf die geblümten Laken, auf die mein Großvater damals gebettet lag wie auf einer Blumenwiese. Darunter entdecke ich schließlich die Umkleidekabine. Ein schlauchartiger, bodenlanger Umhang aus Frotteestoff, unter dem sich Oma früher beim Baden umgezogen hat. Der Umhang war am Hals mit Gummiband gerafft. Aus dieser Tülle guckte oben Omas Kopf heraus. Wir betrachteten ihre Metamorphose mit Faszination. Sie glich einem überdimensionalen Osterei, blau mit weißen Punkten.
Der Stoff fühlt sich rau an unter meinen Fingern. Plötzlich befällt mich eine große Dringlichkeit. Ich muss diesen Umhang unbedingt retten. Weil in ihm eine ganze Kindheitswelt wohnt. Eine Welt, die ich mit Oma geteilt habe und an die sich außer mir vielleicht niemand erinnert.
Als ich Oma meinen Schatz zeige, muss sie lachen: Das ist ja die Umkleidekabine. Die war so kommod.
Früher ist Oma oft mit der Nachbarin ins Freibad gefahren. Die Nachbarin fuhr besser Auto, aber Oma konnte länger im Wasser bleiben. Jetzt ist der Umhang um einiges länger als Oma. Man könnte sie vollständig darin verschwinden lassen und wieder hervorzaubern wie ein weißhaariges Kaninchen. Während ich noch mit diesem Bild beschäftigt bin, sagt Oma gedankenverloren: Ich glaube, die muss ich aufheben, falls wir mal wieder zusammen Schwimmen fahren.
Jetzt muss ich fast lachen, weil Oma seit zehn Jahren nicht mehr Schwimmen war und auch lange nicht mehr bei der Nachbarin zum Kaffee. Aber ich nicke nur und verstehe, dass Oma den Umhang unbedingt aufbewahren muss. Nur für den Fall.
Ich trage meine Erinnerungen wieder ins Haus. Dann ernte ich ein paar Äpfel vom Baum.
Du musst die Rotbackigen nehmen, ruft die Nachbarin herüber, die, mit der Oma immer schwimmen war. Die schmecken am besten. Ja, sagt Oma, sie halten nur nicht lange. Das macht nichts, sage ich, dann esse ich sie alle auf und komme wieder, wenn ich sie aufgegessen habe. Vielleicht pflanze ich auch einen Kern ein und schaue, ob etwas wächst.
Die Kirchturmuhr schlägt viertel vor sechs. Die Wohnzimmeruhr bei Oma zeigt irgendwas.
Die Äpfel duften wunderbar. Nach Altweibersommer.
Die Mischtechnik-Collage September Blaugold wurde von Myriam Kammerlander selbst erstellt.