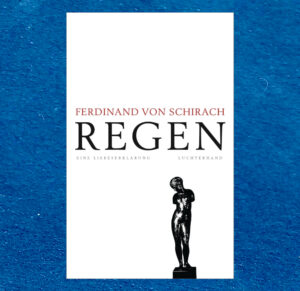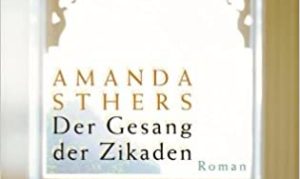von Ulrike Jochum
Der Begriff „Kontrapunkt” kommt aus der Musik und bedeutet im weitesten Verständnis Vielstimmigkeit. Er weist bereits auf die Hauptthemen des Buches hin, sowohl im musikalischen, als auch im übertragenen Sinn — und auf die Verquickung beider.
Die Musik, eine Mutter und eine Tochter stehen im Vordergrund von Anna Enquists neuem Roman „Kontrapunkt”. Wie die Aria aus Bachs Goldberg-Variationen, so ist auch dieses Buch „ein ruhiges, tragisches Lied”. Auf dem Cover sieht man eine Hand, noch in Bewegung, über einer dunklen Wasseroberfläche, auf der sie sich spiegelt. Das Bild strahlt die Stille aus, von der die Geschichte handelt, sowie die Verlorenheit der Mutter: „Ob auch die Stille Musik war, wusste sie noch nicht so recht.” Die spiegelnde Wasseroberfläche erscheint wie eine Grenze, die man nicht durchdringen kann. Für die Mutter liegt dahinter die Vergangenheit, die sie nicht an den „Würgegriff” der Zeit verlieren möchte. Und ihre Tochter. Die Hand auf dem Bild ist klein, vielleicht eine Kinderhand — wie die der Tochter, die, so macht die Bewegung glauben, sich entzieht.
Der Begriff „Kontrapunkt” kommt aus der Musik und bedeutet im weitesten Verständnis Vielstimmigkeit. Er weist bereits auf die Hauptthemen des Buches hin, sowohl im musikalischen, als auch im übertragenen Sinn — und auf die Verquickung beider. Der Grundton der Erzählung ist einfach, auf Ausschmückungen wird verzichtet: „Die Frau hieß einfach nur ‚Frau’, vielleicht auch ‚Mutter’. Es gab Probleme mit der Benennung. Es gab viele Probleme. Im Bewusstsein der Frau waren es vorrangig Probleme mit der Erinnerung.” Eine Frau verliert ihre 27-jährige Tochter und kommt mit dem Verblassen der Erinnerungen nicht klar. Sie ist Pianistin und beginnt zur Bewältigung ihres Schmerzes Bachs Goldberg-Variationen einzustudieren, da sie diese mit einer Zeit verbindet, in der ihre beiden Kinder noch klein waren — 30 Jahre zuvor hatte sie sie schon einmal gespielt.
Die Aria zu Beginn und am Ende sowie deren 30 Variationen bilden das Gliederungsgerüst des Buches. Die Musik nimmt großen Raum ein. Nicht nur ist zu Beginn eines jeden Kapitels ein Notenausschnitt der jeweiligen „Variatio” abgebildet, auch fühlt sich die Frau immer wieder in das Leben des Komponisten, des Meisters der Kontrapunkte Johann Sebastian Bach ein. Doch was noch viel wichtiger ist: Jede Variation beschwört in ihrer evozierten Stimmung vergangene Szenen mit der Tochter herauf. Die Vielstimmigkeit ist auch eine zwischen Mutter und Kind, ein Kanon, zu dem der Vater nach dessen Geburt als Bass hinzukommt — „Der Bass ließ sich nicht mehr wegdenken, er mischte sich ins Geschehen ein und wurde zum unverzichtbaren Bestandteil des Ganzen.” Musik und Leben verquicken sich hier auf das Innigste, und aus der Musik wird schließlich Text: „Durch die Hintertür hatte Bach ihr Zugang zu ihrem Gedächtnis verschafft: Jede Variation hatte Erinnerungen an das Kind wachgerufen, die sie in dem Heft notiert hatte.”
Die Beziehung zwischen Mutter und Tochter ist eng. Die Perspektive der Mutter eindringlich geschildert, tragisch ihr Schock nach dem Auseinanderbrechen der Symbiose, als das Kind älter wird: „Was läuft denn da bloß ab?” Intim ihre Überlegungen bezüglich der erwachsenen Tochter: „Sie will auf den Schoß, und ich will, dass sie zu mir auf den Schoß kommt. So ist das.” Doch etwas stimmt da nicht, die Vorboten des Unheils sind für den Leser spürbar. Liegt es an den großen Schwierigkeiten, die die junge Frau auch nach ihrem Studium noch hat, ins Leben zu finden? Das ist es nicht. Gerade in seiner Zufälligkeit ist ihr Tod umso erschütternder. Wo der Mutter darüber die Worte fehlen, lässt sie Fernesehberichte und Akten sprechen. Auch für ihren eigenen Zustand findet sie bloß Wortbrocken: „Das kalte Kind. Die Schlaftabletten. Die Unfähigkeit zu essen. Die Unfähigkeit. […] Die Inbesitznahme des Friedhofs als Wohnzimmer außer Haus”. Zutiefst traurig sind diese Stellen, wie auch der letzte Abschied — eine Liebeserklärung an ein verstorbenes Kind: „Jetzt spielt sie, jetzt und allzeit spielt die Frau die Aria für ihre Tochter.”
Die holländische Konzertpianistin, Psychoanalytikerin und Schriftstellerin Anna Enquist schrieb einen so zarten wie bewegenden Text über die Fassungslosigkeit eines eigentlich nicht zu verwindenden Schmerzes. Zugleich ist es ein sehr intellektuelles Buch, das auch einem Laien viel über das Wesen und die Möglichkeiten von Musik vermittelt und dann am besten verstanden wird, wenn man sich parallel zur Lektüre auch Bachs Variationen anhört.