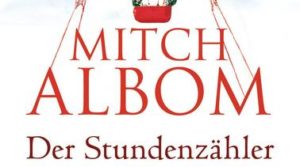von Laura Schmidt, Jona Kron, Larissa Schmid und Steven Gabber
2020 ist vorbei. Zwar bleiben uns die Sorgenerreger des letzten Jahres wohl noch eine ganze Weile treu, doch soll 21 auch Neustart bedeuten. Im Bereich Kritik dient dieser etwas andere Jahresrückblick als Startschuss für die Reihe Textfieber. Es geht um Texte, die uns in Zeiten der Pandemie besonders begleitet haben und dies auf ganz unterschiedliche Art und Weise.
Laura, 20, studiert Vergleichende Literaturwissenschaft, begeistert von ehrlichen Texten und durchdachten Wortspielen
AnnenMayKantereit — 12
Im November 2020 freute ich mich wie kaum über etwas anderes auf das überraschende Erscheinen des dritten Studioalbums von AnnenMayKantereit. Es kam flüchtig, unerwartet, aus dem Nichts. Selbst wenn man genügend Zeit gehabt hätte, sich mit Erwartungen zu wappnen, wären sie wohl nicht mit dem Album konform gegangen. Während die Band normalerweise mit rhythmischen Melodien, mitreißenden Texten und einer poetischen Tiefe begeistert, schien 12 viel mehr roh und ungeschliffen. Zwei Attribute, die sich so wohl auch auf das Jahr 2020 übertragen lassen.
Es ist ein Album, welches die Hörer vielleicht mit mehr Fragen zurücklässt als es Antworten liefert. Doch ist es nicht eben genau das, was dieses Jahr ausgemacht hat?
Henning May, der Sänger der Band, nuschelt ins Mikrofon. Monoton und repetitiv wird mit Versen um sich geworfen, welche nicht richtig ausgearbeitet zu sein scheinen.
“Es ist ein Album aus dem Lockdown. Ein Album, das unter Schock entstanden ist.”, so die Kölner Jungs auf ihrer offiziellen Website über ihr Werk.
Es hat lange Zeit gedauert, mich mit dem Album anzufreunden. Ich wollte mich nicht in eine melancholische Stimmung über die gegenwärtige Situation begeben. Viel lieber wollte ich Lieder zum Mitsingen, Lieder zum Ablenken.
Aber sieht man das Album als Gesamtwerk, so erscheint es letztendlich doch beeindruckend: Jedes Lied ist präzise an einer Stelle im Album platziert. Hinter dem scheinbaren Wirrwarr, hinter dem Nichtssagenden, steht eine durchdachte Collage von Gefühlswelten. Eine Collage des Jahres 2020.
Das Album sagt uns nicht, wie wir mit den Geschehnissen des letzten Jahres umzugehen haben. Aber genau das soll es eben auch gar nicht. Vielmehr individuelle Eindrücke präsentiert, verarbeitet, künstlerisch umgesetzt. Ich habe in 12nicht das eine Werk gefunden, welches mich durch 2020 brachte. Dennoch erschien es mir in Zeiten des Lockdowns als eben das Werk, welches mich am meisten beschäftigt hat. Vielleicht sollten wir alle, ob Corona oder nicht, manchmal einfach innehalten und versuchen, unseren Gefühlen Ausdruck zu verleihen, jede Emotion wahrnehmen und akzeptieren, wie sie ist. Roh und ungeschliffen.
Jona Kron, 27, studiert Vergleichende Literaturwissenschaft, genreübergreifender Musikliebhaber, fasziniert von jedweder Art von Storytelling
Koffee — Lockdown
Wo wollen wir hin, wenn diese ganze Quarantäne vorbei ist? Diese Frage stellt der jamaikanische Shootingstar Koffee im Juli vergangenen Jahres ihrem Schwarm in der Single Lockdown. Die 19-jährige Grammy-Gewinnerin phantasiert von echter Zweisamkeit in Zeiten von Videokonferenzen und ihrem ersten Date nach dem namensgebenden Lockdown.
Die eingängigen Melodien des angenehm basslastigen Instrumentals in Kombination mit dem gekonnten Wechsel zwischen Singsang und Flow-Passagen machen Lockdown zu einem Hörgenuss, auch für Ohren, die mit dem jamaikanischen Englisch wenig vertraut sind. Wenn auch vordergründig ein Liebeslied, so lädt Lockdown doch dazu ein, unwillkürlich selbst ins Schwelgen zu geraten, darüber, was auf der anderen Seite der Quarantäne wartet. Für mich ein knapp drei Minuten langer Lichtblick in einem Jahr, das scheinbar nicht enden wollte.
The Boys
Weiter geht es von der Playlist zur Watchlist und vom optimistischen Träumen zum dystopischen Albtraum. Die Adaption von Garth Ennis gleichnamigen Comicbuch The Boys (Serienlaufzeit 2019 bis dato) ging im vergangenen Jahr in die zweite Staffel.
Die erste Staffel stellte eine brutale Perversion des Superhelden-Genres vor und bescherte dabei der Serienlandschaft den wohl unsympathischsten Antagonisten seit Game of Thrones Cersei Lennister. Die zweite Staffel bietet darüber hinaus — neben einem weiteren ernstzunehmenden Anwärter für diesen Titel — einen verstärkten Fokus auf eine Gesellschaft, die sich konkurrierenden, machtgierigen Drahtziehern ausgesetzt sieht.
Obwohl die Inszenierung durchaus Parallelen zu aktuellen Ereignissen wie dem US-Wahlkampf zulässt, sind Kontext und Umgang mit bekannt anmutenden Motiven stets derart überspitzt, dass sich beide Staffeln von The Boys sehr gut dazu eignen, die Sorgen des Pandemiealltags für ein paar Stunden zu relativieren.
Octavias Brood
Meine letzte Vorstellung ist zwar nicht aus dem vergangenen Jahr, thematisch war die Kurzgeschichtensammlung Octavia’s Brood (2015) allerdings womöglich nie aktueller als in 2020. Im Geiste Octavia E. Butlers präsentieren Herausgeberinnen Adrienne Maree Brown und Walidah Imarisha unter dem Science Fiction Banner 21 dystopische Kurzgeschichten größtenteils afroamerikanischer Schriftsteller, Akademiker und Aktivisten. Trotz der inhaltlichen Brutalität einiger Texte überzeugt diese Sammlung mit der Hoffnung, welche mit dem omnipräsenten Motiv des Wandels einhergeht. Auch wenn sich Octavia’s Brood mit unter 300 Seiten schnell gelesen hat, habe ich für mich persönlich festgestellt, dass es sich oftmals lohnt, einzelnen Geschichten ein wenig mehr Raum zu lassen oder das Buch auch manchmal für den Tag ganz beiseite zu legen.

Larissa, 20, studiert Germanistik und Kunstgeschichte im Bachelor und hat eine Schwäche für Gesamtkunstwerke
Billy Joel — Turnstiles
Teilt man uns im Lockdown in Schwelgende und Konfrontationsfreudige, gehörte ich im Jahr 2020 definitiv ersteren an, die zur Konfrontation mit offensichtlicher Kunst über Corona noch nicht bereit sind.
Ich ließ mich lieber mit Captain Benjamin Willard begleitet von The Doors mystisch-ekstatischen „The End“ immer tiefer in den wahnsinnigen Kriegsdschungel von Apocalypse Now (1979) ziehen. Ich sah lieber das Brechen mit literarischen und filmischen Konventionen, wenn Charles Foster Kanes tot-zitiertes letztes Wort „Rosebud“ in Orson Welles Citizen Kane (1941) kein Schlüssel zur Komplexität eines Lebens sein kann und fiel lieber amüsiert vom Glauben ab, als in der Dokumentarserie Tiger King: Murder, Mayhem and Madness (2020) nach dem Motto „but wait: there’s more“ eine Irrwitz-Kirsche nach der anderen auf das bereits bestehende Absurditäts-Sahnehäubchen drapiert wurde.
Nichts begleitete mich jedoch im letzten Jahr so oft wie Billy Joels viertes Studioalbum Turnstiles (1976) — schon allein weil ich es, nachdem ich endlich eine Kassetten-Ausgabe gefunden hatte, wöchentlich auf dem Weg zu meinen Eltern in meinem 2006er Mini Cooper auf Schleife hörte. So wie sich Billy Joel auf dem Albumcover an einem New Yorker Subway-Drehkreuz befindet, stand er auch im privaten Leben an einem Punkt, an dem er sich vom bunten Hollywood-Treiben in Los Angeles abwandte und in seine Geburtsstadt New York City zurückkehrte. Er verabschiedet sich mit Say Goodbye to Hollywood von Los Angeles, schaut um die Notwendigkeit des Abschieds wissend in I’ve Loved These Days auf die ausgelebten Tage zurück und komponiert mit New York State of Mind eine heute noch oft öffentlich zelebrierte Hymne an seine Heimatstadt. In jedem der acht Lieder erfasst der Interpret Joel mit unglaublichem Gespür eine emotionale und/oder faktische Situation, die subtil und ganz freiwillig ein Nachdenken über Veränderung anregen will. Joel ist in seinen Charakterisierungen und auch in seinem Stimm- und Klavierspiel so feinfühlig, dass er ein Werk von grundlegender und allzu menschlicher Lebendigkeit schafft. Dieses sehr persönliche Album fängt Fragen und Stimmungen der Jugend ein und steht an der Schwelle zum Erwachsenwerden. Summer, Highland Falls reflektiert so eine noch zu rettende (oder eben nicht?) Beziehung, All You Wanna Do Is Dance beobachtet ein Verweigern des Erwachsenwerdens, mit James stellt der Songwriter einen Charakter vor, der sich zu wenig mit seinen eigenen Erwartungen vom (beruflichen) Leben beschäftigt und Prelude / Angry Young Man charakterisiert einen sich gewissermaßen archetypisch dauerhaft bedroht fühlenden jungen Mann, dem eine reifere Erzählerstimme entgegengestellt wird.
Aus der Reihe tanzt das letzte Lied „Miami 2017 Seen the Lights Go Out on Broadway), das in Retrospektive von dem Fall der Stadt New York erzählt. Es ist lustigerweise diese Komposition, welche mich aus dem glamourösen Los Angeles, den nachgefühlten Jugend-Stimmungen und dem „New York State of Mind“ in die manchmal ähnlich dystopisch wirkende Realität des Lockdowns zurückholt. Doch auch in Miami 2017 (Seen the Lights Go Out on Broadway)überdauert die Erinnerung an die guten Zeiten genauso wie an die schlechten Zeiten – die „Show“ stoppt nicht mal der Untergang. Wie Billy Joel in Summer, Highland Falls pointiert schließt, bleibt die Wahl: „It’s either sadness or euphoria“.
Steven, 25, Anglist und Germanist, glaubt an den Tod des Autors
Stanley Kubrick — 2001: A Space Odyssey
Wenn wir aus dem Jahr 2020 eine Lehre ziehen können, dann ist es vielleicht die erneuerte Erkenntnis der Nichtigkeit menschlichen Daseins in einer prekären Lebenswelt. Niemand übernimmt die Verantwortung für eine beliebige Spezies wie der unseren in „ihrem“ sinnentleerten Universum ohne große Narrative, ohne Daseinszweck und ‑ziel. Elementare Bedrohungen für die vermeintliche Krone der Schöpfung sind zahlreich und können vielerlei Gestalt annehmen. Hinter ihnen verbirgt sich kein Plan, kein Sinn und kein Gesetz, außer das des Zufalls. Wer dies verinnerlicht hat, besitzt zwei Handlungsoptionen: Zu resignieren oder selbst die Eigenverantwortlichkeit in einem darwinistischen Überlebenskampf anzuerkennen.
Ein Meisterwerk der Filmgeschichte, das einem diese existenzielle Grenzerfahrung fulminant vor Augen führt, ist Stanley Kubricks 2001: A Space Odyssey aus dem Jahr 1968. Als in die Zukunft gerichtetes Science-Fiction-Epos behandelt der Film die grundlegendsten Bedingungen des Menschseins: Eine Spezies, die eines Tages im Pleistozän beginnt, einen Knochen als Waffe zu gebrauchen.
Eine Spezies, die im fiktiven Jahre 2001 eine Erde bewohnt, die von Nuklearwaffen umkreist wird. Eine Spezies, die künstliche Intelligenz dort einsetzt, wo sie ihr eigenes Wissen als unzureichend erachtet. Diese Ankerpunkte bekommen durch ihre chronologische Anordnung ihre Kohärenz als evolutionäre Fortschrittsbewegung.
Jedoch erweist sich das Prinzip Weiterentwicklung in Kubricks Szenario als eine ambige Angelegenheit, die auch ihre Schattenseiten birgt: Das Erfinden von Waffen schafft die existenzielle Bedrohung, durch sie vernichtet zu werden. Das Erzeugen künstlicher Intelligenz kreiert eine Konkurrenzsituation zu menschlichem Wissen und Können. Erst den Elementen und den eigenen, vergleichsweise bescheidenen, technischen Mitteln ausgesetzt, inmitten der lebensfeindlichen Leere des Weltalls offenbart sich die menschliche Geringfügigkeit. Erfolg und Scheitern liegen meist nur um Haaresbreite voneinander entfernt. Den Unterschied schafft das menschliche Handeln, etwa dann, wenn die Protagonisten den Kampf gegen ihr computergesteuertes Raumschiff aufnehmen müssen.
Für die Realität inmitten einer verheerenden Pandemie folgender Schluss: Ob letztendlich ein Virus oder sein Wirt triumphiert, hängt allein von menschlichem Können und Willen ab. Dem Willen, sich und seine eigenen Bedürfnisse hinter das Wohl der Allgemeinheit zu stellen. Dem Willen, für ein gemeinsames Ziel zu kooperieren. Und dem Willen, in einer Welt ohne Gott als eine Spezies fortzubestehen, für die niemand anderes als sie selbst verantwortlich ist.