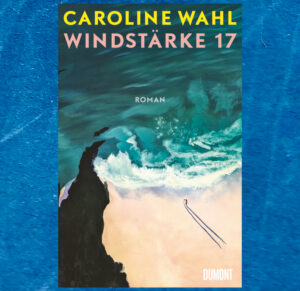von Mirjam Pressler
Jeder, der mit Sprache zu tun hat, vor allem jeder, der meint, Übersetzen sei ja eigentlich ganz einfach, wenn man über den entsprechenden Wortschatz in einer Fremdsprache verfügt, sollte noch einmal lesen, was Mark Twain über die schreckliche deutsche Sprache geschrieben hat: “Bestimmt gibt es keine andere Sprache, die so ungeordnet und unsystematisch, so schlüpfrig und unfassbar ist; man treibt völlig hilflos in ihr umher, hierhin und dahin; und wenn man schließlich glaubt, man hätte eine Regel erwischt, die festen Boden böte, auf dem man inmitten der allgemeinen Unruhe und Raserei ausruhen könne, blättert man um und liest: “Der Schüler beachte sorgfältig folgende Ausnahmen.” Man lässt das Auge darüber gleiten und entdeckt, dass es mehr Ausnahmen als Beispiele für die Regel gibt!” Natürlich geht es hier um das Erlernen der deutschen Sprache, aber es ist nun einmal sie, in die wir übersetzen müssen. Und ehrlich gesagt, ich kann mir wirklich keinen Beruf vorstellen, bei dem der Boden unter den Füßen des Ausübenden schwankender und schlüpfriger ist, als den des Übersetzers. Aber, um beim Bild des Untergrunds zu bleiben: Schon meine Oma hat immer gesagt, wenn es dem Esel zu wohl ist, geht er aufs Eis tanzen. Und vielleicht fühlt er, der Übersetzer, sich ja auch wohl auf dem schwankenden, schlüpfrigen Untergrund, vielleicht gibt ihm das ja den Kick, den er braucht? “Was, Sie sind Übersetzerin? Aus welcher Sprache?”, werde ich oft gefragt, und wenn ich dann sage, “vorwiegend aus dem Niederländischen und Hebräischen”, verziehen sich die Gesichter, die Augenbrauen heben sich, auf der Stirn erscheinen Runzeln, die Lippen runden sich zu einem erstaunten “Oh” oder die Mundwinkel gehen nach unten und ich bekomme ein blasiertes “Ach, wirklich? Interessant.” zu hören. Als gäbe es in diesen Sprachen keine Literaturen. Meist füge ich dann schnell hinzu, dass ich auch schon eine ganze Reihe Bücher aus dem Englischen übersetzt habe. Dann kann ich sicher sein, dass sich die Gesichtszüge meines Gegenübers entspannen, das blasierte Erstaunen weicht erleichtertem Spott, und ich bekomme zu hören, wie viele schlechte Übersetzungen aus dem Englischen man bereits gelesen habe, wirklich, heutzutage traue sich offenbar jeder Idiot, zu übersetzen, wenn er nur drei Jahre Englisch in der Berufsschule gelernt habe, ha-ha. Und wie viele Anglizismen man selbst schon entdeckt habe, für “they rounded the corner …” stand da doch tatsächlich, “sie rundeten die Ecke …”, ha-ha, da ziehe man es doch vor, die Bücher im Original zu lesen, statt sich solchen Unfug bieten zu lassen, beim Original wisse man wenigstens, was man habe. Das selbstgefällige, amüsierte Kichern meines Gegenübers zeigt mir, dass er keine Ahnung hat von der Arbeit eines Übersetzers, einer Übersetzerin. Übersetzen gehört für mich zum Alltag, ich kann es nicht als etwas Abgehobenes sehen. Aus diesem Grund werde ich mich im Folgenden auf meine persönlichen Schwierigkeiten und Freuden beschränken. Denn literarische Texte zu übersetzen, macht Freude. Ich brauche mir nur vorzustellen, ich müsste Bedienungsanleitungen für Waschmaschinen oder Videorekorder übersetzen! Übersetzen ist ein einsames Geschäft, Übersetzer arbeiten im Hintergrund und werden selten gelobt. Man sitzt sozusagen in einer Isolierzelle, abgeschnitten vom Rest der Welt, und grübelt, denn je geübter und trainierter man wird, umso höhere Kriterien legt man an, ohne dass man sie je wirklich mit jemandem diskutieren könnte. Höchstens vielleicht, wenn man einen so guten Lektor hat wie ich. Aber sonst? So etwas wie eine ästhetisch-kritische Auseinandersetzung mit den übersetzerischen Problemen und ihrer verschiedenen Lösungsmöglichkeiten findet nicht statt. Dabei ist doch eine Tatsache unbestreitbar: Ohne Übersetzer gäbe es keine Weltliteratur. Es gäbe keine wechselseitige Inspiration der Schriftsteller, kein Wachsen aneinander, nichts Fremdes, keine Abenteuer und keine Exotik für unsere Träume. Ohne Übersetzer hätte es den Einfluss der Antike nie gegeben, ohne Übersetzer wären die Autoren aller Länder vielleicht im jeweils Völkischen stecken geblieben. Auf jeden Fall wären die Regale in Bibliotheken und Privatwohnungen viel leerer. Trotzdem können Übersetzer froh sein, wenn bei einer Besprechung ihr Name überhaupt erwähnt und vielleicht sogar richtig geschrieben wird. Wären wir Übersetzer in unserem Selbstwertgefühl nur von der Außenwelt abhängig, hätten wir schon längst den Griffel fallen gelassen oder den Computerstecker aus der Steckdose gezogen und uns einer eindeutigeren und auf jeden Fall besser bezahlten Arbeit zugewandt. Aber ein echter Übersetzer rechnet im Geheimen und übt sich in Bescheidenheit, schon weil er keine andere Wahl hat. Gegen wen könnte er sich wehren? Wen könnte er zur Rede stellen? Von wem könnte er Achtung oder wenigstens Beachtung einfordern? Etwa von seinem Arbeitgeber? Von welchem? Ein Übersetzer hat mindestens drei Arbeitgeber, denen er es, will er sich auch in Zukunft Butter auf sein Frühstücksbrot schmieren, irgendwie recht machen muss. Arbeitgeber, die nie ganz zufrieden zu stellen sind und deren berechtigte Ansprüche der Übersetzer insgeheim auch anerkennt, selbst wenn er manchmal mit den Zähnen knirscht und die hinter dem Rücken versteckten Hände zu Fäusten ballt. Da sind erstens der Autor und sein Werk, dann gibt es noch den Verlag und schließlich die Leser. Ein Sonderfall sind die Kritiker. Diese verschiedenen Arbeitgeber bringen den armen Übersetzer unvermeidlich in mehr oder weniger bedrückende Loyalitätskonflikte. Natürlich sollten der Autor und sein Werk ganz oben stehen, aber was man unter Treue dem Werk gegenüber versteht, oder wenigstens verstehen sollte, ist keineswegs eindeutig festgelegt. Ich werde später noch darauf eingehen. Der zweite Arbeitgeber ist der Verlag, und das verkompliziert die Arbeit des Übersetzers schon ungemein. Denn der Verlag ist ja nicht irgendeine abstrakte Institution, es sitzen dort Menschen, die sich berufshalber mit Sprache beschäftigen, genau wie Autoren, Übersetzer, Journalisten und Andere. Sie werden dafür bezahlt, dass sie Wörter und Formulierungen finden und diese dann auch hinschreiben, vorzugsweise in das Manuskript, das der Übersetzer nach wochen- oder monatelanger Arbeit hoffentlich rechtzeitig abgeliefert hat. Der Lektor nimmt das Manuskript, ohne sich vorher durch stilles Versenken und das Anzünden einer Kerze in die angemessene Stimmung versetzt zu haben, und macht sich an die Arbeit. Natürlich hat er dafür nicht wochen- oder monatelang Zeit, schließlich wartet die Druckerei und er hat ja auch noch etwas anderes zu tun. Und außerdem ist er selbst gewissen Zwängen ausgeliefert. Zum Beispiel muss er sich profilieren und seinem eigenen Arbeitgeber, dem Verlagsleiter nämlich, die Notwendigkeit seines Arbeitsplatzes beweisen. Manche Lektoren glauben nun, die richtige Methode, dies zu tun, bestünde darin, nach Gutdünken in der Arbeit des Übersetzers herumzufummeln, womöglich sogar, ohne ihn überhaupt in ihre Überlegungen einzubeziehen. Zehn, zwanzig geänderte Wörter und Formulierungen pro Seite sind gar nicht so selten. Diese Änderungen sind zuweilen überflüssig, oft geschmäcklerisch, und manchmal verändern sie die Sprachebene und wirken dann sogar verfälschend. Die Entscheidung für oder gegen ein bestimmtes Wort ist eine Sache des Gefühls und des Geschmacks. Immer könnte man das Geschriebene auch ganz anders formulieren, einen Satz anders komponieren, und diese alternativen Möglichkeiten fallen bestimmten Lektoren auch prompt ein. Oft sind es aber genau die Varianten, die der Übersetzer — vielleicht nach langem Abwägen — verworfen hat. Im schlimmsten Fall ist der Lektor also der Feind des Übersetzers. Aber er kann auch sein bester Freund sein, sein Mitstreiter und Kumpan, sein Helfer und Retter vor der Betriebsblindheit, die auch Übersetzer einholt, wenn sie nur lange genug an einem Werk arbeiten. Bestimmte Eigenheiten einer fremden Sprache werden einem dann so vertraut, dass man überhaupt nicht mehr merkt, dass sie durchs Übersetzen falsch werden. Jede Übersetzung entsteht unter einem gewissen Termindruck und wird auch zu schlecht bezahlt, als dass der Übersetzer es sich leisten könnte, abzuwarten und seine Arbeit nach einigen Wochen noch einmal — und diesmal distanzierter — zu beurteilen. Diesen distanzierten Blick wünscht er sich vom Lektor, und dieser Wunsch wird zum Glück auch manchmal erfüllt. Dann nämlich, wenn der Lektor Bücher liebt, wenn er sich in Geschriebenes einfühlen kann, wenn er einem Text dienen möchte und bereit ist, sich auf jenen Balanceakt zwischen Sich-Einbringen und Sich-Zurücknehmen einzulassen, wie er auch von Übersetzern erwartet wird. Vielleicht ist die Einsamkeit des Übersetzers ja schuld daran, dass seine Erwartungen an Lektoren oft zu hoch sind und deshalb zwangsläufig von Zeit zu Zeit enttäuscht werden müssen. Die Liebe zu Büchern, besonders zu dem einen, dem speziellen, das man gerade übersetzt, ist die wichtigste Voraussetzung für eine gute Arbeit. Das gilt für beide gleichermaßen, für den Lektor und den Übersetzer. Eigentlich müsste Übersetzen doch ganz einfach sein. Man hat den Text und die Figuren, der Handlungsverlauf ist festgelegt. Man braucht nur noch, vielleicht mit Hilfe eines Wörterbuchs, den vorgegebenen Wörtern und Sätzen zu folgen. Aber warum findet man dann einerseits immer wieder schlechte und mittelmäßige Arbeiten, andererseits kongeniale, um nicht zu sagen geniale? Weil es nämlich nicht um die Wort-für-Wort oder Satz-für-Satz-Übersetzung eines Textes geht. Wäre das so, könnte auch ein Computer übersetzen. Das klappt aber nicht, wie jeder leicht feststellen kann, wenn er übersetzte Gebrauchsanweisungen für Videorekorder oder andere Geräte liest. Und dabei handelt es sich bei diesen Gebrauchsanweisungen nicht um Literatur, sondern um die bloße Benennung klar definierbarer Handgriffe an klar definierbaren Teilen. Ein Schalter links oben ist ein Schalter links oben, müsste man meinen, egal in welcher Sprache. Beim Übersetzen literarischer Werke geht es aber nicht nur um die bloße Benennung, um das korrekte Wort, sondern um die Stimmung, die Atmosphäre und den Sprachduktus eines Buchs. Es geht darum, dass ein Buch in der Übersetzung annähernd so gut, gleich gut oder sogar (wegen des doppelten und dreifachen Lektorats) noch besser ist als im Original. Wird das erreicht und genießen deutsche Leser ein Buch so, wie es die Leser der Originalsprache tun, dann kann man von einer gelungenen Übersetzung sprechen. Es ist wie in der Musik. Man hat die Noten, man hat eine gewisse Fingerfertigkeit, man kann sich ans Klavier setzen und das Musikstück nachspielen. Trotzdem: Selbst wenn man keinen Fehler macht, kann etwas völlig anderes herauskommen als der Komponist gemeint oder der Zuhörer erwartet hat. Die Darbietung kann hölzern sein, ausdruckslos, steif und wenig ansprechend. Ton für Ton oder Wort für Wort ist vielleicht deckungsgleich, solide und korrekt, aber das Ergebnis bleibt seelenlos und stumpf, wenn es dem Interpreten am Gefühl und am Verständnis für das Werk fehlt. Oder nehmen wir ein anderes Bild, den Fährmann. Er fährt mit seinem Floß über den Fluss zwischen zwei Ländern. Sein Auftrag ist es, ein Buch von einem Land ins andere zu bringen. Die Fahrt über den Fluss geschieht unter einer ungeheuren Spannung, ob das Buch heil ankommt, ob es auch so verstanden wird, wie es verstanden werden will, ob nicht Eigentümlichkeiten des Herkunftslandes dazu führen, dass es im Zielland zum Beispiel als Kitsch abgetan und zum Sterben verurteilt wird. Auf seiner Fahrt von einer Welt zur anderen, von einem Ufer zum anderen, ist der Fährmann sehr allein, er hat nur das Buch — und die Hoffnung, dass er es heil an Land bringt und dass es gut “ankommt”. Der Fluss, über den der Fährmann fährt, ist die Sprache. Oft muss er Untiefen ausweichen, Strömungen, Stromschnellen und Strudeln, zuweilen gibt es Gegenwind oder gar Sturm, und manchmal, zum Glück nur selten, geht das Floß unter, und der Fährmann muss das Buch, für das er die Verantwortung übernommen hat, auf dem eigenen Rücken an Land bringen. Der Fährmann, der Über-Setzer, lebt in einer Zwischenwelt, und seine Heimat ist die Sprache. Warum übersetze ich überhaupt, wenn es ein so schwieriges Unterfangen ist, bei dem man ‑zumindest stellenweise — zwangsläufig scheitern muss? Die einfachste Antwort auf diese Frage ist: Erstens ist es eine Arbeit, mit der ich einen Teil meines Lebensunterhalts verdiene, und zweitens macht es mir Spaß. Diese Antwort ist allerdings unzureichend, denn erstens gehört Übersetzen nicht gerade zu den gut bezahlten Jobs, und zweitens ist es viel mehr als nur Spaß: Ich liebe Bücher im Allgemeinen und manche Bücher im Besonderen. Und wenn ich ein Buch mag, überfällt mich so etwas wie missionarischer Eifer, dann möchte ich, dass andere Leute, andere Leser, ebenfalls erfahren, wie schön, gut, anregend, interessant oder was auch immer dieses Buch ist. Übersetzen ist ein intellektuelles Vergnügen, etwas, das bei weitem den Genuss des Nur-Lesens übersteigt. Es führt zu einer tiefgehenden Kommunikation mit dem Autor, manchmal ist es fast, als würde man in die andere Person hineinkriechen. Die Grenzen zwischen Autor, Werk und Übersetzer verschwimmen. Zugleich ist Übersetzen eine Kommunikation mit den Lesern. Denn seltsamerweise denke ich, wenn ich selbst ein Buch schreibe, nie an zukünftige Leser, wohl aber beim Übersetzen. Manchmal, wenn ich glaube, eine besonders gelungene Formulierung gefunden zu haben, freue ich mich bei dem Gedanken, dass irgendjemand beim Lesen stutzen wird, ich stelle mir vor, wie er oder sie anfängt zu lachen, wie er oder sie traurig oder nachdenklich wird, je nachdem. Ich möchte nicht verschweigen, dass es auch andere Gefühle gibt, die einen Übersetzer erfassen können. Das heißt, es sind meine Gefühle, ich habe keine Ahnung, ob andere auch so empfinden. Da ist zum Beispiel Neid auf den Autor, die Autorin, die ich gerade übersetze, weil es ihm oder ihr offenbar so schwerelos gelungen ist, etwas auszudrücken, was in mir selbst verborgen war, was ich aber erst jetzt, in diesem Moment, erkennen kann. Übersetzer müssen sich aber auch immer wieder mit Argumenten gegen das Übersetzen auseinandersetzen. Ihre Arbeit, ihr Beruf, wird angezweifelt. Eines der ältesten Argumente, das durch die häufige Verwendung allerdings auch nicht besser oder richtiger wird, ist, man könne nur entweder verfremdend oder einbürgernd übersetzen, man müsse sich zwischen der “belle infidèle” oder der “hässlichen Treue” entscheiden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Übersetzer dieses Entweder-Oder ohne weiteres akzeptierten wird. Meines Erachtens ist es immer ein Sowohl-als-auch, beide Methoden gehen ineinander über, mischen sich und lassen sich im besten Fall nicht mehr voneinander trennen. Ich gehe davon aus, dass reine Entweder-Oder-Versionen nicht besonders attraktiv werden können. Jede Übersetzung ist eine neue Herausforderung und eine Anmaßung, ein Balanceakt zwischen Treue zum Original und dem Dienst am neu entstehenden Buch, und dazwischen bewegt sich die Treue zum Autor. Ist seine Sprache im Original flüssig und elegant, darf sie in der Übersetzung nicht kompliziert oder gar holprig sein, ist sie knapp und präzise, darf sie nicht literarisch “aufgepeppt” werden. Bei guten Autoren ist das Problem geringer als bei eher schlechten bis mittelmäßigen, es ist wirklich eine Faustregel: Je besser ein Autor ist, umso genussvoller lässt er sich übersetzen. Das bedeutet, dass man auch Schwierigkeiten gerne in Kauf nimmt. Diese Regel gilt in meinem Fall vor allem bei Übersetzungen aus dem Niederländischen. Nahsprachen erlauben eine gewisse Ähnlichkeit in der Wortwahl, und bestimmte Satzkonstruktionen lassen sich oft einfach übernehmen. Trotzdem ist das Übersetzen, auch von Nahsprachen, ein ständiges Hin und Her zwischen vorgegebenen Strukturen und den Möglichkeiten, die die eigene Sprache bietet. Da sich die Bedeutungsfelder der einzelnen Wörter in Herkunftssprache und Zielsprache fast nie decken, wird jedes Übersetzen zwangsläufig zu einem Interpretieren. Wie hat es der Autor gemeint? Wo liegen seine Schwerpunkte? Lassen sich syntaktische Strukturen übernehmen? Sollen sie übernommen werden, wenn sie im Deutschen schwerfälliger und umständlicher wirken als im Original? Ein Buch, dem man ständig die grammatikalischen Bedingungen der Herkunftssprache anmerkt, kann nicht wirklich gut übersetzt sein. Besonders viele Beispiele dafür gibt es aus dem Englischen bzw. dem Amerikanischen, und Formulierungen wie “alter Junge” führen dazu, dass man “not amused” die Augenbrauen hochzieht. Ganz zu schweigen von englischsprachigen Ausdrücken wie “It makes no sense”, die immer häufiger, in diesem Falle als “es macht keinen Sinn”, im Deutschen auftauchen. Dadurch, dass dieser Unsinn wiederholt wird, ergibt er im Deutschen noch lange keinen Sinn. Aber es ist unsinnig, sich darüber zu streiten, irgendwann wird er im Duden landen, als Denkmal eines unbekannten Übersetzers. Wichtiger als die “Richtigkeit” einer Übersetzung ist mir in vielen Fällen die “Stimmigkeit” eines entstehenden Buchs, seine Schönheit. Falsch übersetzte Wörter oder Formulierungen machen, obwohl sie natürlich nicht vorkommen sollten, ein Buch nicht wirklich kaputt. Sie lassen den Leser höchstens verwundert den Kopf schütteln, aber meist wird er etwaige Fehler einfach überlesen, wenn sie im Kontext nicht besonders auffallen. Ich habe vor ein paar Jahren einmal sehr gestutzt, als ich die deutsche Übersetzung eines israelischen Autors las und auf eine Stelle stieß, an der ein Mann über einen anderen sagte: “Er hat Blut, er hat Eier.” Der Sinn dieser rätselhaften Worte wurde mir erst klar, als ich diese beiden Formulierungen rückübersetzte: “Jesch lo dam, jesch lo beizim.” Zwei Aussagen, die das gleiche bedeuten, nämlich: “Er hat Mut.” In diesem Fall hätte man also übersetzen können: “Er hat Mut, er traut sich was.” Für einen deutschsprachigen Leser musste diese Stelle unverständlich bleiben, ein englischsprachiger hätte sich möglicherweise etwas dabei denken können, schließlich kennt er die Formulierung: “He has the guts to do something.” Wie allerdings dem zuständigen Lektor der deutschen Übersetzung diese Aussage durch die Lappen gehen konnte, werde ich nie verstehen. Noch etwas fällt mir zu Fehlern ein. Anneliese Schütz, die Übersetzerin der alten Leseausgabe des Tagebuchs der Anne Frank, übersetzte einmal “rötliche Kartoffeln”. Bei Anne Frank waren sie allerdings “rot”, d. h. “faulig, verfault”, denn “rot” heißt auf Niederländisch “rood”. An einer anderen Stelle schrieb Anne “de hele rataplan”, d. h.: “der ganze Kram, der ganze Haufen”. Schütz kannte das Wort “rataplan” wohl nicht und übersetzte es mit “das ganze Rattennest”. Dennoch sind es nicht diese Fehler, die ihre Übersetzung des Tagebuchs insgesamt “falsch” machen, sondern die unangemessene Sprachebene, die falsche Farbe. Eben der falsche Ton. Grundsätzlich gilt, dass der Übersetzer die richtige Sprachebene finden muss, den adäquaten Sprachstil und — vor allem — den richtigen Sprachrhythmus, denn bei den einzelnen Sätzen stimmen weder die Anzahl der Wörter noch die Zahl der Silben überein, und der Wortfluss ist die Voraussetzung für die Betonung bestimmter Wörter und macht den Rhythmus einer Sprache aus. Der ist meines Erachtens für die Schönheit eines Textes ebenso wichtig wie die Sprache selbst, ja, bringt sie erst zum Klingen. Probieren Sie doch einmal, einen kleinen Text mit jeweils Fünf-Wort-Sätzen oder beispielsweise Sieben-Silben-Sätzen zu schreiben und lesen sie die dann laut vor. Hier muss man, denke ich, jedoch unterscheiden, welche Art Text man zu übersetzen hat. Bei Lyrik sind die Anforderungen sicherlich anders als bei Prosa, und bei Prosa für Kinder und Jugendliche wieder anders als bei der für Erwachsene. In der “großen” Literatur wird es viel eher um Genauigkeit gehen, bei Kinder- und Jugendbüchern mehr um die “Schönheit” einer Übersetzung, um ihre Lesbarkeit — und außerdem um die Lesegewohnheiten von Kindern und Jugendlichen. Dabei denke ich vor allem Bücher aus dem Hebräischen, das Niederländische bietet in dieser Hinsicht weit weniger Schwierigkeiten. Es ist sicher nicht einfach, die adäquate Sprachebene zu finden, denn es gibt dafür nur wenige greifbare Anhaltspunkte, eine originelle Wortwahl oder komplizierte Satzkonstruktionen reichen nicht aus. Ist es Intuition, die einen Übersetzer dazu bringt, so oder so auf einen Text zu reagieren, dieses oder jenes Wort zu wählen, sich für die eine oder andere Satzform zu entscheiden, und zwar immer wieder, durch ein ganzes Buch hindurch? Wenn er ständig nachdenken müsste, wenn er jeden Satz neu in Frage stellen würde, käme nie im Leben ein flüssiger, lesbarer Text heraus. Der Leser würde an den Stellen stolpern, an denen er flüssig weiterlesen sollte, und über andere hinweglesen, die ihn eigentlich dazu bringen sollten, innezuhalten. Jeder Übersetzer, jede Übersetzerin hat wohl eine eigene Methode, mit diesem schwer fassbaren Phänomen der Sprachebene und dem, “was zwischen den Zeilen steht”, umzugehen. Ich würde auch gerne wissen, wie es die anderen machen, aber normalerweise wird gerade darüber nie gesprochen. Ich kann Ihnen also nur erzählen, wie ich es mache, und diese Auskunft ist nicht besonders aufschlussreich. Aber nicht etwa deshalb, weil ich nicht bereit wäre, mein Geheimnis zu verraten, sondern weil es kein Geheimnis gibt, weil ich es selbst nicht besser weiß. Ich fange eine Übersetzung an und warte einfach, bis ich “die Antwort aus dem Bauch” bekomme. Manchmal dauert es zehn Seiten, ein andermal aber auch dreißig, vierzig, bis ich merke: Jetzt! Jetzt hab ich’s! Fragen Sie mich ja nicht, was dieses “Es” ist, aber es ist da, und wenn ich es erst einmal spüre, begleitet es mich normalerweise durch die ganze Übersetzung. Da ich mich auf diese Erfahrung verlassen kann, werfe ich, habe ich diesen Punkt erst einmal erreicht, die bereits übersetzten Seiten weg und fange neu an. Übersetzen ist also auch Gefühlssache. Natürlich ist die Kenntnis der Herkunftssprache erforderlich, das gehört so selbstverständlich zum Handwerkszeug, dass man es nicht zu erwähnen braucht. Weit wichtiger ist jedoch die Kompetenz in der Muttersprache, der geschriebenen Muttersprache, der kreative, sensible und verantwortungsbewusste Umgang mit ihr, die Freude, die Hingabe, die Besessenheit. Ich denke, dass dies auch ein Grund dafür ist, dass sich gerade unter solchen Menschen viele Übersetzer finden, die selbst schreiben und erst über das Schreiben zum Übersetzen gelangen. Damit möchte ich nicht behaupten, dass ein guter Übersetzer immer selbst Autor sein sollte. Aber von einem bin ich überzeugt: Dass nämlich ein Übersetzer auch ein Leser sein muss, und nicht nur ein einfacher Leser, sondern ein leidenschaftlicher. Er muss sich auf einen Text einlassen können, ihn nicht nur intellektuell erfassen, sondern auch erfühlen können und spüren, was “zwischen den Zeilen” steht. Wörter und Begriffe, auch schwierige, kann man nachschlagen, aber es ist, glaube ich, ein gewisser Instinkt nötig, um aus den verschiedenen Definitionen das richtige Wort herauszusuchen. Geben Sie doch spaßeshalber einmal einen simplen, belanglosen Satz wie “Insekten können eine wahre Plage sein” in den Computer ein und ändern Sie die Wörter mit Hilfe des Thesaurus. Ich nenne hier nur zwei der vielen möglichen Ergebnisse: “Kerbtiere sind imstande, ein tatsächliches Ärgernis zu sein.” Und: “Mücken besitzen die Gabe, eine wahrhaftige Bürde darzustellen.” Inhaltlich wären diese beiden Varianten nicht falsch, aber die Empfindungen, die sie wecken, sind andere. Es ist ein Spiel, das mir von Zeit zu Zeit viel Vergnügen bereitet. Oder in der Thesaurusalternative: “Es ist ein Zeitvertreib, der mir zuweilen viel Belustigung produziert.” Dabei fällt mir noch ein Zitat von Mark Twain ein: “Der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem annähernd richtigen ist wie der Unterschied zwischen einem Blitz und einem Glühwürmchen.” Ein Übersetzer, der nicht gerade größenwahnsinnig ist, wird sich, wenn er bestimmte Formulierungen nicht kennt, kompetente Hilfe suchen. Als es bei der Übersetzung der Historisch-Kritischen Ausgabe der Tagebücher der Anne Frank um die “Handschriftenvergleichung” ging (es heißt wirklich so, nicht “Vergleich der Handschriften”), war ich ziemlich hilflos. Nicht dass ich den Text nicht verstanden hätte, mir waren Wörter wie “Aufstrich” und “Abstrich”, “Schlaufen” und “Häkchen” durchaus ein Begriff, aber dieser Text war viel detaillierter. Ich hatte zwar das Gefühl, alles zu kapieren, wusste aber nicht, in welche deutschen Worte ich diese Erkenntnisse fassen sollte. Ich arbeitete ein entsprechendes Fachbuch durch, ohne dass meine Unsicherheit wirklich beseitigt wurde. Daraufhin schrieb ich an den Autor dieses Werks, damals Professor an der Universität Heidelberg, und erklärte ihm mein Dilemma. Zu meinem Erstaunen war er sofort bereit, mir zu helfen und die entsprechenden Passagen zu korrigieren. Ein andermal wusste ich nicht, wie ich die Verse eines Kinderlieds übersetzen sollte, freier und mit simplen Reimen, oder originalgetreuer und dadurch komplizierter. Ich rief bei der niederländischen Botschaft an, und dieser Anruf entwickelte sich außerordentlich vergnüglich. Ich wurde an mindestens zehn Menschen weitervermittelt, und jeder ließ sich genüsslich mein Problem erklären, bis mir am Schluss eine Frau das Lied einfach vorsang. Da wusste ich, für welche der beiden Alternativen ich mich zu entscheiden hatte, nämlich für die freiere, simplere. An dieser Stelle möchte ich auf einen Vorteil des Übersetzens hinweisen, der nicht zu verachten ist: Übersetzen bildet ungemein. Und noch etwas: Ich bin weder größenwahnsinnig noch bilde ich mir ein, selbst alles herausfinden zu können. Deshalb habe ich zwei Menschen, die für mich jede Übersetzung am Schluss noch einmal mit dem Original vergleichen. Sie sind in ihren jeweiligen Sprachen Muttersprachler, haben ein gutes Sprachgefühl und sprechen ausgezeichnet Deutsch. Für das Niederländische ist das Francien Garritsen, für das Hebräische Eldad Stobezki, der wunderbarerweise auch noch Anglistik studiert hat. Diesen beiden, Francien und Eldad, verdanke ich bei meiner Arbeit ein gehöriges Maß an Sicherheit und Unbefangenheit. Außer der Richtigkeit der gewählten Formulierung spielen die Assoziationen, die von einzelnen Wörtern hervorgerufen werden, eine wichtige Rolle. Assoziationen, die sich umso mehr unterscheiden, je weiter der kulturelle Hintergrund der Herkunftssprache von der Zielsprache entfernt ist. Das setzt voraus, dass ein Übersetzer natürlich auch Kenntnisse in der Geschichte und Kultur und sogar in den geographischen Bedingungen des Herkunftslands haben muss. So wird sich ein deutsches Kind mit Sicherheit unter dem Wort “Wüste” etwas anderes vorstellen als ein israelisches. Israelische Kinder denken vermutlich genau wie deutsche an die schmerzhaft brennende Sonne, aber auch daran, wie kalt es dort in Winternächten ist und dass in Wüsten sogar Menschen ertrinken können, wenn die Wadis plötzlich voller Wasser sind. Deutsche Kinder haben nur gelben Sand vor Augen, israelische haben bestimmt alle schon erlebt, wie die Wüste nach einem Regenfall plötzlich aufblüht. Und sie kennen das blassgraue Grün der Bäume und die vielfarbigen Felsen. Normalerweise spielen die verschiedenen optischen Vorstellungen bei der Übersetzung von Prosa keine besondere Rolle, sie kommen lediglich zu den ohnehin vorhandenen, individuell geprägten und biographisch bestimmten Assoziationsketten hinzu, die sich je nach Bildungsstand, Leseerfahrung und persönlichen Erlebnissen unterscheiden und auf die man als Übersetzer oder Übersetzerin keinen Einfluss hat. Und manchmal werden bestimmte Unverständlichkeiten ja auch im Laufe des Buchs aufgelöst, das heißt, das deutsche Kind kann seine persönliche optische Vorstellung von “Wüste” erweitern und differenzieren. Übersetzer tun aber gut daran, sich diese Unterschiede von Zeit zu Zeit in Erinnerung zu rufen, damit sie bei ihrer Arbeit umso sorgfältiger mit Assoziationsmöglichkeiten umgehen und gewisse Unterschiede nicht unbeachtet übergehen. Größere Schwierigkeiten bereiten Wörter, die eine Kenntnis des kulturellen oder religiösen Hintergrunds des Herkunftslandes voraussetzen, zum Beispiel die Namen von Festen. Kommen in einem Manuskript viele solcher Begriffe vor, bietet es sich an, ein Glossar anzufügen, auch bei Kinder- und Jugendbüchern. Tauchen nur wenige und leicht erklärbare Wörter auf, kann man eine Fußnote machen, wie z. B. in Büchern von Ida Vos das Wort “mof, moffen — Schimpfwort für Deutsche”. Eine Möglichkeit ist es, den Text zu glätten und eventuell störende Fremdheiten herauszunehmen. Als Beispiel dafür könnte man das hebräische Fest “Bar Mizwa” nehmen. Es ließe sich sinngemäß mit “Konfirmation” übersetzen, da der Bar Mizwa (der Gebotspflichtige) im Alter dem Konfirmanden in etwa entspricht. Ich halte das jedoch für unzulässig, weil es den Unterschied zwischen den Religionen negiert. Man könnte natürlich auch das betreffende Wort durch einen kurzen Zusatz im Text erklären, doch das unterbricht den Erzählfluss und birgt die Gefahr, den Text holprig, sperrig oder zumindest umständlich zu machen. Falls es sich nicht anbietet, dem Text ein Glossar beizufügen, neige ich dazu, das fremde Wort unerklärt stehen zu lassen. Wenn ich ein Buch lese, verstehe ich auch nicht immer jedes Wort, warum sollte es Kindern anders ergehen? Etwas “Fremdes” einfach umzumodeln oder zu verschlucken, kann ja wohl nicht das Ziel sein. Und jeder Übersetzer muss sich damit abfinden, dass es Details, Wörter, Bilder und Formulierungen gibt, die nicht übersetzbar sind. Ich habe in einem Buch, das ich vor einigen Jahren aus dem Amerikanischen übersetzt habe, ein wunderbares Beispiel dafür gefunden, das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Das Buch heißt “Jiddisch. Eine Sprache reist um die Welt”, von Miriam Weinstein. Das betreffende Beispiel spielt in einer Zeit, in der es in Israel absolut verpönt war, Jiddisch zu sprechen. Wer es tat, wurde auf der Straße angepöbelt, und Kioskbesitzer, die jiddische Zeitungen verkauften, mussten damit rechnen, dass ihr Kiosk angezündet wurde.
Man erzählt von einem Mann namens Schtibl, der in den frühen Tagen der Pionierzeit Soldaten zusätzlich zum Lehrplan Boxunterricht erteilte. Er wurde beschuldigt, seinen Unterricht auf Jiddisch zu halten. Er verteidigte sich mit dem Argument, dass Hebräisch mit nur vier Wörtern für Schlag, Ohrfeige, Stoß und Faustschlag nicht genug Ausdrucksmöglichkeiten habe. Er beschrieb die jiddischen Alternativen: Ein trockener Schlag aufs Kinn, der deinen Kopf zum Singen bringt, ist a sbeng. Ein normaler Schlag, nicht zu hart: a patsch. Aber ein brennender Schlag, der einen roten Fleck auf deinen Wangen hinterlässt: a flask. Ein sehr schneller Schlag mit der offenen Hand, der dich so verwirrt, dass du nicht weißt, was los ist: a wisch. Eine harte Rechte, die dir mindestens eine Rippe bricht: a knok. Ein Schlag aufs Auge, der für wenigstens zwei Monate lang ein Veilchen hinterlässt: a schnit. Ein Schlag mit dem Handrücken, der deine Unterlippe platzen lässt und dir manchmal auch einen Zahn ausschlägt: a riß. Eine kräftige Kopfnuss, die den Kopf des Gegners gegen die Wand haut: a sez. Eine langsame, aber starke Ohrfeige: a flik. Ein hingewischter Schlag, der weniger heftig als beleidigend ist und an der Stirn beginnt und die Haare über das ganze Gesicht wischt: a schmir. Sein Vorgesetzter war überzeugt. Der Boxunterricht wurde auf Jiddisch fortgesetzt.
Zu den größten Schwierigkeiten beim Übersetzen gehört alles, was bei uns Kitsch wäre, es aber in der Herkunftssprache nicht ist. Das Deutsche hat eine reiche Kitschtradition, andere Sprachen, z. B. das Jiddische, nicht. Jiddisch war bis ins 18. Jahrhundert eine vorwiegend gesprochene Sprache und geht daher viel unbefangener mit Wörtern und Formulierungen um, die im Deutschen längst von der Trivialliteratur vereinnahmt und geschändet worden sind. Beispiele: ein schmollender Blondschopf, lustig funkelnde Blauaugen, inniges Lächeln, glühendes Herz usw. Daraus folgt: Kitsch, der im Original nicht unbedingt als Kitsch empfunden wird, muss in der Übersetzung korrigiert werden. Dieser Eingriff ist nicht nur berechtigt, er bedeutet geradezu Treue dem Original gegenüber. Dazu gehören auch gewisse Fehler, die in der Herkunftssprache nicht als solche gewertet werden. Zum Beispiel: Du lügst, gähnte er. Oder: Nein, sprang er vom Stuhl. Zu den Erzählkonventionen im Deutschen gehört, dass als Regieanweisung bei wörtlicher Rede nur Verben des Sagens und Meinens zulässig sind. Veränderungen gegenüber dem Original sind manchmal also durchaus berechtigt. Gar nicht so selten kommt es bei Übersetzungen zu Abweichungen vom Original, die, so wie ich es erlebt habe, oft aber nicht vom Übersetzer vorgenommen werden, sondern vom Verlag, das heißt von Lektoren. Größere Eingriffe sind meines Erachtens nur zulässig, wenn das Buch so bedeutsam ist, dass seine Verbreitung wichtiger erscheint als die Treue dem Original gegenüber, z. B. dann, wenn gewisse Tabus in der Zielsprache besonders groß sind. Als Beispiel möchte ich hier “Das Tagebuch der Anne Frank” nennen. In die neue, weltweit gültige Leseausgabe wurde eine Passage aufgenommen, in der Anne Frank die weiblichen Genitalien beschreibt. Bei der Diskussion mit dem Anne-Frank-Fonds, dem Rechteinhaber, bestand ich darauf, dass in die Verträge ein Passus aufgenommen wurde, der es ausländischen Verlagen erlaubt, diese Passage wegzulassen. Ich wollte unbedingt verhindern, dass das Tagebuch in besonders prüden Ländern aus diesem Grund vielleicht überhaupt nicht neu veröffentlicht werden würde. Ein anderes Problem ist die Lesbarkeit. Besonders bei Übersetzungen hebräischer Kinder- und Jugendliteratur kann es angebracht sein, in den Satzrhythmus einzugreifen. Ein sehr klarer syntaktischer Aufbau der hebräischen Sprache (Subjekt, Prädikat, Objekt) führt dazu, dass dem Hauptsatz durch “und” lange Reihungen verschiedener Nebensätze angefügt werden können, ohne dass die Verständlichkeit — auch für jüngere Kinder — darunter leidet. Im Deutschen müssen derartige Satzreihen oft in mehrere Einzelsätze zerlegt werden, weil der kindliche (langsamere) Leser sonst den Anfang schon vergessen haben könnte, wenn er beim Prädikat angelangt ist. In diesem Zusammenhang spielen auch zeitgebundene Sprach- und Lesegewohnheiten eine Rolle. Für die meisten Kinder wäre es z. B. heute unmöglich, die langen, für heutige Begriffe verschachtelten Sätze alter Kinderbücher auf Anhieb zu verstehen. Aber: Der Übersetzer, die Übersetzerin muss jeden Eingriff begründen können. Das bedeutet ständiges Reflektieren, Interpretieren, Entscheiden. Oft habe ich schon dagesessen, besonders bei Übersetzungen aus dem Hebräischen, und mir überlegt, ob es in einem bestimmten Satz wichtig ist, ein Substantiv zu erhalten, oder ob ich es nicht lieber in ein Verb umwandle, weil der Satz sonst auf Deutsch zu bombastisch klingt, zu aufgebläht. Als Anfängerin habe ich sehr viel Zeit mit derartigen Überlegungen verbracht, inzwischen bin ich allerdings so trainiert und erfahren, dass ich mich auf meine Intuition verlassen kann. Übersetzen muss ständig geübt werden, ähnlich wie ein Musiker üben muss, um seine Fingerfertigkeit zu erhalten. Für einen Anfänger bedeutet das einen großen Zeitaufwand, zusätzlich zur eigentlichen Übersetzungsarbeit. Bei mir haben sich viele Trainingsvorgänge schon so automatisiert, dass ich, wenn ich ein ausländisches Buch lese, unwillkürlich überlege, wie ich bestimmte Passagen übersetzen würde, auch wenn ich mit dem Buch beruflich nichts zu tun habe, ich also weder beauftragt bin, ein Gutachten zu erstellen, noch es in Hinblick auf eine mögliche Übersetzung lese. Und wenn ich die deutsche Übersetzung eines ausländischen Autors lese, halte ich immer wieder inne und denke: Das hat der Übersetzer aber wunderbar hingekriegt. Oder: Das hätte ich anders übersetzt. Und dann versuche ich den Grund für meine Begeisterung oder für meine Ablehnung herauszufinden. Ebenso überlege ich beim Lesen immer wieder, welche Assoziationen bestimmte Passagen oder Wörter in mir hervorrufen. Assoziationen haben viel mit dem Gefühl, der eigenen Biographie und Lesebiographie zu tun. Ich möchte Ihnen ein, wie ich finde, anschauliches Beispiel dafür geben, nämlich ob in einer Übersetzung ein Baum gefällt oder umgeschlagen wird. Beim Fällen assoziieren wir “fallen”, wir sehen den Riesen, der fällt, empfinden automatisch Bedauern und so etwas wie Ehrfurcht. Der Satz hat eine gewisse Tragik. Ganz anders ist es, wenn der Baum umgeschlagen oder umgehauen wird. Da sehen wir die Männer vor uns, die mit brutaler Gewalt dem Baum zu Leibe rücken. Der Satz hat etwas Gewalttätiges. Die Formulierung “einen Baum fällen” ist allerdings typisch deutsch, ich kenne ihn aus anderen Sprachen nicht. Man muss also beim Übersetzen entscheiden, auf welche Art es dazu kommen soll, dass der Baum am Schluss auf dem Boden liegt. Eine Regel kann es für solche Probleme nicht geben, ebenso wenig wie die einzig mögliche, korrekte Übersetzung. Manches ist — samt den dazugehörigen Assoziationen — nicht zu übersetzen. Die wohl bekanntesten Beispiele sind “die Sonne” und “der Mond”. In vielen Sprachen ist die Sonne männlich und der Mond weiblich. Wenn ein französischer pubertierender Knabe “la lune” anschmachtet, wird der Leser automatisch in eine andere Stimmung versetzt, als wenn ein gleichaltriger deutscher Junge den Mond betrachtet. Das Bild bleibt romantisch, klar, aber es fehlt die Erotik, die “la lune” den Franzosen schenkt. Und wenn es sich bei Kinderbüchern um Tiergeschichten handelt, kann man durch das andere Geschlecht der Substantive ganz schön ins Schwitzen kommen, besonders wenn die entsprechende Illustration einen zwingt, den Tieren ein anderes als das grammatikalische Geschlecht zu verleihen. Die Lösung, aus der “Kröte” einen “Kröterich” zu machen, ist leider nicht immer möglich. Oft sind es auch die Defizite der deutschen Sprache, die Übersetzern und Übersetzerinnen das Leben schwer machen. Da ist zum Beispiel der Ausdruck “das junge Mädchen”, das mit dem Wort Mädchen als Bezeichnung für ein weibliches Kind auch noch dieses unselige grammatikalische Geschlecht — die persönliche Geschlechtslosigkeit — gemein hat. Wobei das “junge Mädchen” ohnehin schon eine plumpe Hilfskonstruktion ist, um sie (oder es?) vom Kind-Mädchen zu unterscheiden, denn das Wort “Frau” ist eindeutig eine erwachsene Frau und weckt andere Assoziationen, obwohl es in manchen Kreisen immer üblicher wird, auch Vierzehn- oder Fünfzehnjährige als Frau zu bezeichnen. Aber eine Zwölfjährige? Das junge Mädchen, die sich für ein Fest schminkt? Das geht nicht, bei “das Mädchen, die” sträuben sich einem die Nackenhaare. Aber “das junge Mädchen, das sich für ein Fest schminkt?” Da sträubt sich mein Bewusstsein. Sie ist doch kein Kind mehr, sie hat doch ein Geschlecht und ist sich dieser Tatsache gerade bei der Vorbereitung auf ein Fest wohl ganz besonders bewusst. Mit dem “jungen Mann” ist es nicht viel besser, nachdem uns Wörter wie “Jüngling” und “Bursche” so gut wie abhanden gekommen bzw. nur noch in Begriffen wie “Burschenherrlichkeit” erhalten geblieben sind, das Wort “Jugendlicher” von den Soziologen vereinnahmt ist und “Minderjähriger” auch keine Alternative bietet. Auf Hebräisch fallen mir auf Anhieb acht Bezeichnungen ein, vom zarten Knaben bis hin zu einem jungen Mann, bei dem jeder sofort weiß, dass er religiös ist. (rach, jeled, bachur, na´ar, rawak, katin, za´ir, awrech). Eine andere deutsche Eigenheit macht Übersetzern das Herstellen korrekter Bezüge oft schwer, nämlich das Wörtchen “sie”. Nur ein paar Beispiele: Sie geht nach Hause. Ich sehe sie. (3. Pers. Sing. Nom. und Akk.) Sie singen ein Lied. Ich höre sie singen. (3. Pers. Plural Nom. und Akk.) Dazu kommt “Sie” als Anrede. Im Hebräischen gibt es für “sie” einschließlich der Höflichkeitsform vierzehn verschiedene Wörter, je nachdem, ob Singular oder Plural, Maskulinum oder Femininum, Nominativ oder Akkusativ gemeint ist: hi, ota, hem, otam, hen, otan, ata, otcha, at, otach, atem, otchem, aten, otchen. Allein das “sie” ist häufig dafür verantwortlich, dass eine Eins-zu-eins-Übersetzung nicht möglich ist. Ein Beispielsatz: “Sie gehen auf der Straße, als sie sie treffen und sie fragen: Haben Sie sie gesehen? Hat sie sie gebeten, dass sie ihr sagen, sie müssten sie abholen?” Eine der unzähligen Aufschlüsselungen könnten sein: “Klaus und Peter gehen auf der Straße, als sie Frau X treffen und sie fragen: Haben Sie Frau Y gesehen? Und hat Frau Y Tomas und Anna gebeten, dass sie der Tante sagen, sie müssten die Oma abholen?” An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass das Deutsche wiederum durch die drei Artikel “der, die, das”, die als Relativpronomen benutzt werden können, manchmal korrekte Anschlüsse besonders leicht macht. Schwierigkeiten bereitet oft auch das Anrede-Sie: Ted van Lieshout lässt in seinem Buch “Bruder”, einer Geschichte, die in den sechziger Jahren spielt, die Kinder ihre Eltern mit “Sie” anreden. In den Niederlanden war das damals in Familien gehobener Gesellschaftsschichten noch üblich. Würde man es korrekt übersetzen, klänge es auf Deutsch albern. Wegen dieses Problems kam es fast zum Bruch zwischen Autor, Verlag und mir. Im Hebräischen gibt es, genau wie im Englischen, kein “Sie”, außerdem ist die Anrede Herr oder Frau Soundso nicht üblich und wird nur bei Menschen benutzt, die sehr viel älter oder sozial wesentlich höher gestellt sind. Wenn ich zum Beispiel in Israel in einem Reisebüro anrufe und einen Flug buche, wird die Angestellte die Buchung annehmen und sagen: Also, Mirjam, dein Flieger geht um acht Uhr zehn. Vergiss nicht, dass du eine halbe Stunde eher da sein musst. Sogar Lehrer werden üblicherweise mit dem Vornamen angeredet. Bei einer Übersetzung muss man ständig überlegen, wie die Beziehung zwischen den Personen ist, ob sie sich hier duzen würden, und wenn nicht, an welcher Stelle sie vermutlich vom “Sie” zum “Du” wechseln. Die Faustregel “spätestens nach dem ersten Kuss” lässt sich nur bei Liebespaaren anwenden. Ich habe schon oft genug fertige Übersetzungen noch einmal überarbeitet, weil ich nachträglich die Anrede für falsch hielt. Außer bei Wörtern, Wortfeldern, Assoziationen und Bezügen gibt es natürlich noch andere Probleme. Bei Übersetzungen aus dem Hebräischen sind das vor allem Schwierigkeiten, die sich auf den Umgang mit den Zeiten zurückführen lassen. Auch beim Schreiben können israelische Autoren und Autorinnen ohne ersichtlichen Grund von einer Zeit in die andere springen, ohne dass ihnen das per se als Fehler angerechnet wird. Ganz abgesehen davon, dass es im Hebräischen keine zusammengesetzten Zeiten gibt, weder Perfekt noch Plusquamperfekt, ganz zu schweigen vom zweiten Futur. Es gibt auch keinen Konjunktiv und keinen Irrealis. Das macht, zusammen mit den fehlenden Perfektzeiten , das Übersetzen von indirekter Rede zu einem Drahtseilakt, der ohne Interpretation — mit der ständigen Gefahr von Fehlern — nicht zu bewältigen ist. Deshalb behaupte ich, dass es eine “richtige” Übersetzung aus dem Hebräischen nicht gibt. Man muss ständig überlegen und entscheiden, ob etwas wirklich passiert ist, ob die Figur sich das Geschriebene vielleicht nur wünscht oder denkt, und falls man sich für die Version “wirklich passiert” entscheidet, überlegt man, wann es passiert ist oder passieren wird, vor dem gerade Erzählten oder danach, oder gar erst in der Zukunft. Der Versuch, dieses Problem mit dem israelischen Autor zu klären, ist nach meiner Erfahrung von vornherein zum Scheitern verurteilt. Die meisten Israelis haben im Englischunterricht zwar von diesen seltsamen Zeiten gehört, können aber ihre wirkliche Bedeutung nicht nachempfinden, auch nicht unsere Reaktionen auf den Umgang israelischer Autoren mit der Zeit. Wie stark Lesegewohnheiten unsere Rezeption von Büchern beeinflussen, beweist zum Beispiel, dass ich, wenn ich ein hebräisches Buch lese, keinerlei Schwierigkeiten mit der Zeit habe. Ich stolpere erst darüber, wenn ich anfange zu übersetzen. Das meines Erachtens schwierigste Problem beim Übersetzen aus dem Hebräischen besteht allerdings darin, eine adäquate Sprachebene zu finden, da die gesprochene Sprache und die literarische Sprache noch viel weiter auseinanderklaffen als beispielsweise im Englischen und die Umgangssprache eher zögernd Eingang in die Literatur findet. Eine der jüngeren Autorinnen, die sich auf geniale Weise auf dieses Abenteuer einlässt, ist z. B. Zeruya Shalev. Bei manchen, vor allem jüngeren und noch unerfahrenen, Autoren führt diese Diskrepanz zwischen gesprochener und geschriebener Sprache aber leicht dazu, dass sie ihre Sprache hochschrauben und aus einem einfachen Bild oder Gedanken einen “geschwollenen Furz” machen. Diese Formulierung stammt aus dem Hebräischen, nod nafu´ach, und ist so bildhaft, dass ich sie hier gerne übernehme. Oft fehlt dem Original auch das Lektorat. Nicht in allen Ländern ist ein Lektorat in unserem Sinn allgemein üblich. (Ganz nebenbei, auch bei uns geht es leider immer mehr verloren, was man manchen Büchern auch deutlich anmerkt.) Fehler, die ich in Kinder- und Jugendbüchern gefunden habe und die eigentlich ein Lektor hätte finden müssen, waren unter anderem: Frösche quakten zur falschen Jahreszeit, Brombeeren und Himbeeren trugen zur gleichen Zeit Früchte. In Westafrika wuchsen Bäume, die es dort gar nicht gibt. Beim Übersetzen sollte man vorsichtshalber alles nachschlagen. Ich habe ja schon gesagt, dass Übersetzen bildet. Auch falsche oder schräge Bilder lassen sich nicht einfach übernehmen. Deutsche Leser — und vor allem deutsche Kritiker — können nicht wissen, ob das schräge Bild dem Original oder dem Übersetzer zuzuschreiben ist. Kritiker werden in einem solchen Fall sofort den Übersetzer beschuldigen. Andererseits muss man sich davor hüten, falsche Bilder in einen Text hinein zu übersetzen. So sollte in einem Buch, das in Israel spielt, auf keinen Fall jemand mal eben “hereinschneien”. Zum Abschluss der beschriebenen Probleme möchte ich als Beispiel ein paar Sätze anführen. Es handelt sich um den Text, den eine sehr gute Autorin vor über zwanzig Jahren geschrieben hat, als ambitionierte, sehr junge Frau. Ich bin mit ihr befreundet, deshalb habe ich den Übersetzungsauftrag übernommen, aber wir saßen drei Tage zusammen, um die fraglichen Stellen zu klären. Ein Mann beschreibt das Grabbildnis einer Frau. Im Original heißt es: Nun erst schaue ich sie wirklich an. Ihr Gesicht ist oval, die Farbe hat den Ton von Wüstensand. Sie hat eine gerade Nase, ein senkrechter Strich läßt ihre Nachdenklichkeit in Tropfen fallen. Edle Augen, dünne Wimpern in den Winkeln. Sorgfältige Brauen. Wie die Nase am Ende heruntergleitet. Über der Lippe ein Grübchen wie ein Kind. Unschuldig. Der Engel schlägt das Neugeborene auf den Mund. Es erinnert sich nicht mehr an die Zufluchtsstätte im Bauch. Nach Absprache mit der Autorin heißt es jetzt auf Deutsch: Ihr Gesicht ist oval, ihre Haut hat die Farbe von Wüstensand. Sie hat eine gerade Nase mit tropfenförmigen Nasenflügeln. Darüber zwei große, mandelförmige Augen. Edle Augen, in den Winkeln die zarten Linien ihrer Wimpern. Auch ihre Brauen sind sorgfältig gemalt. Die Einbuchtung über der Oberlippe wie bei einem Kind. Unschuldig. Der Engel zeigt dem Ungeborenen sein ganzes zukünftiges Leben, aber einen Moment vor der Geburt legt er ihm den Finger auf den Mund, um das Gesehene aus dem Bewusstsein zu löschen. Das Philtrum ist der Abdruck des Engelfingers. Übrigens: Dies ist auch ein Beispiel dafür, wie ein Text erweitert wird, um etwas Unverständliches zu erklären. Ich hätte diesen Zusatz allerdings ohne den ausdrücklichen Wunsch der Autorin nicht angebracht. Ein zweites Beispiel: Mein Vater fragte vorsichtig, ob ich vielleicht Lust hätte, Jura zu studieren. Meinte er, ich würde den Faden seiner Vertreibung nähen? Auf Deutsch wurde es: Hat er geglaubt, ich würde das vollenden, was er einmal angefangen hatte? Und ein drittes Beispiel: Ein Arzt sagt über seine Patientin, eine alte Frau: Seit sie zugelassen hatte, daß ich ihr das Gesicht abwischte, hatte sie ein weiteres Blatt abgeworfen. Es flatterte noch durch das Zimmer, unsichtbar, aber unangenehm riechend. Auf Deutsch heißt es: Seit sie zugelassen hatte, dass ich ihr das Gesicht abwischte, hatte sie, wie eine Zwiebel, eine weitere Schale abgeworfen, unsichtbar, aber nach Verfall riechend. Und noch ein letztes Beispiel: Eine Therapeutin erzählt von einer Patientin: Sie sagte zu mir: “Wenn du zuhören musst, welche Abwässer sich zwischen Menschen verbergen, dann ist mein Schlamm nicht besser und nicht weniger gut.” In der deutschen Übersetzung steht: Sie sagte zu mir: “Wenn Sie sich anhören müssen, welche üblen Dinge sich zwischen den Menschen abspielen, dann ist das, was ich Ihnen zu erzählen habe, nicht besser und nicht schlechter.” Wie gesagt, drei Tage haben die Autorin und ich daran gearbeitet, aber es war eine schöne Arbeit, die ich nicht missen möchte. Es war eine der wenigen Gelegenheiten, die sich einem Übersetzer bieten, seine Einsamkeit bei der Arbeit zu überwinden. Ich bin der privilegierten Situation, dass ich in der Regel die Bücher aussuchen kann, die ich übersetzen möchte. Natürlich spielen literarische Überlegungen dabei die Hauptrolle. Daneben geht es mir aber auch darum, wie wichtig die Bücher in politischer, sozialer oder psychologischer Sicht sind, was Leser erfahren können, was sie meiner Meinung nach unbedingt erfahren müssten. Allerdings kann ich mich bei meiner Auswahl nur nach dem richten, was ich von Verlagen angeboten bekomme. Denn es gibt eine sehr platte Aussage, die trotz ihrer Banalität nicht weniger wahr ist: Übersetzer werden auch dafür gebraucht, dass die Verlage Geschäfte machen. Bücher sind nun einmal Waren, und niemand weiß das besser als Übersetzer. Verlage bringen oft das Argument vor, ein paar Euro Seitenhonorar mehr führten dazu, dass man ein Buch nicht mehr kalkulieren könne. Warum allerdings beim schwächsten Glied in der Kette, die zur Entstehung eines Buches notwendig ist, gespart werden muss, beim Übersetzer, der Übersetzerin, ist mir nicht ganz einsichtig. Wir liefern eine ordentliche Arbeit — und Übersetzen ist, bei allem Vergnügen, eine anstrengende Arbeit — und sollten dafür angemessen bezahlt werden. Wenn es denn so teuer ist, Bücher übersetzen zu lassen, warum gibt es dann so viele Übersetzungen, nicht nur in der Kinder- und Jugendliteratur? Darauf gibt es wohl mehrere Antworten: Verlage können sich aus der Vielzahl der ausländischen Bücher die Rosinen herauspicken und Bücher übersetzen lassen, die sich in ihrem Heimatland bereits bewährt haben, sei es, dass sie sich gut verkauft oder dass sie besonders gute Kritiken bekommen haben. Ein anderer Grund ist bestimmt auch, dass Fremdes, Andersartiges in der Regel spannender ist als das, was man bereits kennt. Und selbstverständlich lese ich lieber etwas über Israel, was von israelischen Autoren geschrieben ist, als das, was ein deutscher Autor, der vielleicht einmal ein paar Wochen Urlaub im Land gemacht hat, mir darüber erzählen möchte. Zusammenfassend lässt sich sagen: Übersetzen ist vielfältig. Andere Kulturen — und somit auch ihre Literaturen — sind nicht nur spannend, weil sie “anders” sind. Sie bieten uns nicht nur Informationen über andere Länder, von denen wir sonst nicht viel wissen, sondern sie machen uns auch mit den in diesen Ländern bevorzugten Einstellungen, Werten und Normen bekannt. Wir erfahren etwas über die Art, wie Menschen miteinander umgehen, wie sie ihre persönliche Lebenswelt organisieren und sie, so gut es eben möglich ist, lebenswert machen. Das ist nicht nur spannend, sondern kann uns vielleicht auch auf neue Ideen bringen. Das Übersetzen von Büchern ist wichtig, weil es der Völkerverständigung dient, weil wir durch die Arbeit von Übersetzern und Übersetzerinnen fremde Kulturkreise kennen lernen, weil wir unseren Horizont erweitern, weil unsere Literatur ohne das Neue, Fremde um vieles langweiliger wäre. Wie arm wäre unsere Literatur, wenn wir nicht durch Übersetzungen fremde Farbigkeiten und fremde Ideen kennen lernen könnten! Wie arm wären wir, wenn wir uns mit dem Deutschtum und den in deutscher Sprache geschriebenen Büchern begnügen müssten! Und wie arm wären umgekehrt auch andere Kulturen, wenn sie auf deutsche Bücher verzichten müssten! Meiner Meinung nach ist die Literatur eines der wenigen Gebiete, auf dem der viel beschworene multikulturelle Austausch wirklich gedeiht. Dafür bin ich als Übersetzerin und vor allem als Leserin immer wieder dankbar.