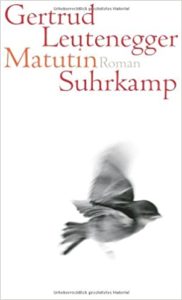Ein Gespräch mit Thomas Lehr
von Aura Heydenreich
“Es geht mir um die Durchdringung und Kritik dieser medialen Oberfläche, die wir aktuell so überlebensgroß serviert bekommen. Ich versuche, die Ereignisse mit literarischen Mitteln besser aufzuschließen. Wenn man das tut, lässt sich eine neue Tiefendimension erzeugen.”
SCHAU INS BLAU: Herr Lehr, in diesen Tagen ist Ihr neuester Roman „September. Fata morgana” erschienen. Nach den vorgehenden Romanen, die um philosophische und poetologische Themen kreisen — geschichtsphilosophische Themen in ihrem ersten Roman „Die Erhörung”, das Wesen der Zeit in „42″, medienphilosophische Reflexionen in „Nabokovs Katze” — wenden Sie sich im neuen Roman einem brisanten Thema zu, dem 11. September, der politisch-militärischen Vorgeschichte dieses Anschlags und seinen kulturellen Implikationen. Der Anschlag auf das World Trade Center ist das medial prägende Ereignis unseres Jahrzehnts. Welche neuen Dimensionen und Perspektiven lassen sich durch die literarische Verarbeitung dieses Themas erschließen?
THOMAS LEHR: Es geht mir um die Durchdringung und Kritik dieser medialen Oberfläche, die wir aktuell so überlebensgroß serviert bekommen. Ich versuche, die Ereignisse mit literarischen Mitteln besser aufzuschließen. Wenn man das tut, lässt sich eine neue Tiefendimension erzeugen. Sowohl die zeithistorischen Erweiterungen des Konflikts (so habe ich versucht, die Geschichte des Irak in den letzten Jahrzehnten einzublenden), als auch die avancierten Sprachtechniken der Literatur können dazu beitragen. Auf diese Weise ergibt sich eine Chance, eine vielschichtigere Darstellung der historischen Auseinandersetzung zu erreichen. Was ich suchte, war — wenn ich es gehoben ausdrücken dürfte — eine Transzendierung des aktuellen historischen Objekts. Es ist eine paradoxe Bemühung, die nie zur Zufriedenheit gelingen kann, die aber einen großen Reiz hat: das zeitgeschichtlich Verrinnende gewissermaßen in Echtzeit oder sehr unmittelbar nach dem Ablauf der Ereignisse transparent und wahrhaftig darzustellen.
SCHAU INS BLAU: Ich greife die Frage auf, die Ihnen Florian Felix Weyh auf dem Poetenfest gestellt hat, weil ich sie in diesem Zusammenhang wichtig finde: Muss man sich beim Schreiben über dieses kontroverses Thema eine Meinung machen?
THOMAS LEHR: Bei „September” war es eine Selbstüberwindung, diesen Stoff überhaupt anzugehen. Ich habe einen großen Widerwillen gehabt, mich als deutscher Autor auf das Thema Nahost einzulassen, weil es einfach so kompliziert erscheint, weil man zu wenig Ahnung davon hat, weil man sich unberaten fühlt, weil man als Deutscher historisch eine große Komplexität mit allen Fragen verbindet, die sich mit Israel befassen und man lieber nicht dahin schauen möchte. Das habe ich zu überwinden versucht, indem ich diese Ratlosigkeit an meine Figuren weitergegeben habe. Da ist der Germanistikprofessor, der sich zuvor auch nicht mit dem Nahen Osten beschäftigen will, und jetzt aber (nach dem Tod seiner Tochter im World Trade Center) einen furchtbaren Grund dafür hat. So kam ich hinein in dieses Thema. Das Gute ist, dass ich so lange an einem Thema arbeiten kann, bis das bloße Meinungmachen überwunden ist. Ich musste zum Beispiel versuchen, in einem Roman die Dialektik der Werturteile über den Irakkrieg einzubringen. Einerseits kann man — wie ich es tue — den Irakkrieg für falsch halten, weil er völkerrechtswidrig war und mehr Elend geschaffen zu haben scheint als vorher schon bestand. Andererseits zeige ich in meinem Buch auch ganz klar die Grauenhaftigkeit des Saddam-Regimes, so dass jeder Leser erkennt, dass dieser Krieg wenigstens einen Vorteil hatte: dass der Diktator beseitigt wurde. Das sehen viele Iraker auch so. Aber viele glauben, dass der Preis zu hoch war. Ob die Iraker in fünfzehn Jahren sagen werden: Die Toten zählen nicht mehr so viel, wir sind froh, dass wir eine Demokratie geworden sind? Wer weiß. Im Moment kann man das noch nicht sagen. Im Moment ist das noch nicht abgeschlossen. Als Romancier kann ich aber Figuren setzen, die ihre Empörung, ihre Angst und ihre Meinungen äußern können. In der Vielfalt und Differenzierung der Figurenwahrnehmung kann sich der Roman einer gewissen Wahrheit oder besser: einer wahrhaftigen Darstellung der Ereignisse nähern.
SCHAU INS BLAU: Durch die Rückblenden der Erlebnisse eines des Protagonisten, Tarik, schildern Sie die letzten fünfzig Jahre irakischer und vorderasiatischer Geschichte: vom Sechstagekrieg, über die beiden Golfkriege, bis zur Irakinvasion der U. S. A. Wie gestaltete sich die Recherche zu einem solch komplexen Thema?
THOMAS LEHR: Tarik war die schwierigste Figur des Romans. Ich habe mir diesen mittfünfzigjährigen irakischen Arzt ausgesucht, der in Frankreich studiert hat, weil er über so ein klares und vielfältiges Bewusstsein verfügen kann. Diese Wahl hatte für mich als Autor weitreichende Folgen. Ich musste mir diese Figur mühsam erarbeiten. Ich musste seine Lebenstationen, seine Denkstationen rekonstruieren, Jahrzehnt für Jahrzehnt. Das konnte ich zum Teil journalistisch machen, durch das Studium der vorhandenen Geschichtsliteratur, sofern sie zugänglich war. Dann aber waren auch direkte Dialoge mit Irakern vonnöten, um über das Buchstabenwissen hinauszukommen. Nachdem ich mich so einigermaßen in die irakische Geschichte der letzten siebzig Jahre eingearbeitet hatte, bin ich zu den Irakern gegangen und habe mit ihnen darüber gesprochen. Als sie merkten, dass ich relativ viel über ihr Land wusste und äußerst neugierig war, habe ich sehr viel Resonanz bekommen. Ich konnte mit ihnen über die Geschichte Iraks in den 60er, 70er Jahren in einen sehr lebhaften Dialog treten, daraus habe ich die Figur geformt.
SCHAU INS BLAU: Die historischen und politischen Ereignisse nach dem 11. September und der dadurch ausgelöste Krieg sind jedoch nur eine Ebene des Romans. Es gibt noch weitere Dimensionen, Sie gehen gleichzeitig auf die frühe hochkulturelle Tradition Mesopotamiens ein und stellen diese in Form von fragmentarischen Reflexionen in inneren Monologen der irakischen Protagonisten dar. Auf welchem Wege fanden Sie diesen breiten, fundierten Zugang zur irakischen Kultur, und wie lässt sich diese Tradition in Prosa verarbeiten?
THOMAS LEHR: Die Verbindung zu den alten geschichtlichen Wurzeln liegt ja auf der Hand, man findet sie in fast jedem Zeitungsbericht: Wenn man in den Irak einmarschiert, kommt man nicht umhin, auf die Urzeugnisse unserer gemeinsamen zivilisatorischen Wurzeln zu stoßen, irgendwann steht man in Babylon. So wie wir alle wissen, was der Kölner Dom bedeutet, so wissen die Iraker etwas über den Turm zu Babel. Diese Dinge sind nicht nur lebendig, sondern sie sind auch im Irak ständig Gegenstand des Selbstbildes — also musste ich mich damit beschäftigen. Die Auseinandersetzung mit der älteren Vergangenheit des Irak kann man viel leichter führen, weil die wissenschaftliche Literatur hierfür viel umfassender und viel abgeklärter ist. So kann man sich relativ gut einarbeiten in halbwegs solide recherchierte historische Hintergründe. Die sind einfacher zugänglich als das, was in den letzten fünfzig Jahren dort passiert ist.
SCHAU INS BLAU: Sie hatten angedeutet, dass Sie die Figuren bewusst ausgewählt haben. Es fällt natürlich auf, dass es kulturelle Grenzgänger sind: Martin, der deutsch-amerikanische Literaturwissenschaftler, und Tarik, der irakische Arzt, der in Paris studiert hat. Gleichzeitig finde ich die Idee spannend, den Bewusstseinsstrom der Figuren als permanenten west-östlichen Dialog zu inszenieren, so dass die Figuren stets teils versuchen, sich in die Kultur der Anderen hineinzudenken, teils versuchen, das eigene Leben, die eigene Kultur zu vermitteln.
THOMAS LEHR: Das Grundthema der kulturellen Grenzgänger schien mir aufschlussreich, weil ich damit auch zeigen konnte, dass diese Kulturen viel miteinander zu tun haben. Über die gemeinsamen Schnittflächen kann man ein Verständnis entwickeln. Auch die Amerikaner sind uns oft fremd. Und wenn man sich einen Deutsch-Amerikaner vorstellt, einen Deutschen, der eine amerikanische Frau geheiratet und ein deutsch-amerikanisches Kind hat, dann hat man plötzlich einen sehr innigen Zugang zur Selbstdefinition Nordamerikas oder zu der Bostoner Szenerie, in der Martin lebt, zu diesem Uramerika. Man wird durch die Figur ganz automatisch in dieses Milieu hineingeführt. Und da ist auf der anderen Seite eine Figur wie Tarik, die drei Sprachen spricht und in Europa studiert hat. Menschen wie er sind überhaupt nicht selten. Unter dem Saddam Regime sind schon Hunderttausende geflohen, diese Intellektuellen sind gewissermaßen weltweit verbreitet. Andererseits war ich auch in den U.S.A. und habe mich mit etlichen Professoren unterhalten, die eine ganz ähnliche Geschichte wie Martin haben. Ich meine, an diesen Grenzgänger-Figuren ist gar nichts Künstliches. Es gibt sie einfach, und sie haben sehr aufschlussreiche Perspektiven.
SCHAU INS BLAU: Martin, der Protagonist, verliert beim Anschlag auf das World Trade Center seine Ex-Frau und seine Tochter. Dadurch verlagert sich der Schwerpunkt seiner Forschungen weg von Goethe und dem 19. Jahrhundert und hin zu den Hintergründen des Attentats. Er geht den fundamentalen kulturellen Differenzen zwischen der westlichen und der östlichen Kultur nach — wobei diese einfache Dichotomie bei näherer Betrachtung gar nicht aufrecht zu erhalten ist. Hartnäckig stellt er sich die Frage: „Warum hassen sie uns?” Nun ist der literarische Text sicherlich nicht dazu da, einfache Antworten zu geben, sondern steht eher dafür, die ungelösten Probleme in ihrer Komplexität aufzuzeigen. Welche Defizite des interkulturellen Dialogs waren Ihnen in diesem Zusammenhang wichtig?
THOMAS LEHR: Mir kam es eher darauf an, die humanitären Gemeinsamkeiten zu entdecken und von dort aus auf Unterschiede hinzuweisen, die hauptsächlich in den soziokulturellen Lebensumständen liegen. Ein Arzt wie Tarik in Bagdad hat ein anderes Leben als ein Arzt in Massachussets. Und das habe ich ganz konkret gezeigt, mit Beschreibungen, die ich versucht habe, möglichst genau zu machen.
SCHAU INS BLAU: Der Roman formuliert auch eine Kritik an machtpolitischen Verhältnissen in den U. S. A. und entlarvt die Diskrepanz zwischen der mangelnden politischen Legitimation des Krieges und den Strategien der Regierung, diese fehlende Legitimation zu kompensieren: Die mediale Manipulation, getarnt als sachlich-objektive Information.
THOMAS LEHR: Das Verhältnis zwischen dem Ereignis und dessen medialer Repräsentation ist gerade in den Irakkriegen zweimal zum wichtigen Thema geworden. Zum einen gab es die strikte Gängelungspolitik im Golfkrieg 1991, in dem die Journalisten gemaßregelt und mit Scheuklappen versehen wurden oder auch zum Teil abgestraft, wenn sie es wagten, etwas anderes zu filmen, als man ihnen vorgab. So hat man sie dann im nächsten Krieg mit dem „embedding-Konzept” auf eine raffiniertere Weise eingebunden, man hat ihnen versprochen, dass sie alles tun dürften, in jede Aktion eingebettet sein würden, weil man wusste, dass man eine neue mediale Stärke schaffen musste. Dadurch sind natürlich auch wieder Chimären entstanden. Gerade durch dieses neue „embedding”-Konzept fokussierte sich die mediale Berichterstattung darauf, wie es in den alliierten Truppen zuging, denn die Journalisten waren in die amerikanischen Truppen eingebettet und nicht in die irakische Bevölkerung. Ob das beabsichtigt war oder nicht, bliebe zu untersuchen. Auch das wollte ich konterkarieren, indem ich mich selbst in irakische Figuren hineinversetzte. Es ging mir darum, den Konflikt aus verschiedenen Perspektiven beider Kulturen zu schildern, also durch das erweiterte poetische „embedding” das gesteuerte politische „embedding” aufzuheben.
SCHAU INS BLAU: Im Roman ist zu beobachten, wie die Figuren stets nach logisch nachvollziehbaren Begründungen für diesen Krieg suchen und wie sie versuchen, sich Zuversicht einzureden, dass es für die Zeit nach der Invasion einen Wiederaufbauplan geben wird. Und wenn man im Vergleich feststellt, wie unvorbereitet das Verteidigungsministerium der größten militärischen Macht bezüglich der Wiederaufbaustrategie war: Es fehlten tiefere Einsichten in die Geschichte der ethnischen Konflikte Iraks, es fehlte die genauere Kenntnis der politisch-kulturellen Zusammenhänge, es fehlte der Wille zum Schutz kultureller Denkmäler…
THOMAS LEHR: Es ist sehr wichtig zu verstehen, wie das zustande kam. Das konnte ich im Roman nicht so ausführlich darstellen. Ich habe versucht, es im Kapitel, das ich „Embedded President” überschrieben habe, nachzuvollziehen: die Mechanik der Administration in einer der mächtigsten Demokratien der Welt. Ich bin der Frage nachgegangen, an welchen Stellen sie in ihren Mechanismen undemokratisch wird, und wie das denn eigentlich funktioniert, dass so eine gescheiterte Politik zustande kommt. Das hat mich interessiert: die Mechanik der Macht. Amerika ist eine Demokratie. Wir in der Demokratie müssen begreifen, wie das funktioniert, um Wiederholungen zu verhindern.
SCHAU INS BLAU: Das Konzept des „embedded journalism” suggerierte nach außen Authentizität und Objektivität, war davon aber weit entfernt — nichts anderes als „Hofkriegsberichtserstattung”. Ihr Roman setzt sich damit kritisch auseinander, dass das transportierte Bild vom Krieg höchst selektiv ist. Das brechen Sie auf, indem Sie zeigen, dass es viele Facetten gibt, die in den medialen Repräsentationen der Macht, die Krieg führt, unberücksichtigt blieben.
THOMAS LEHR: Ich habe versucht, das im Buch deutlich zu thematisieren und den Blickwinkel zu öffnen. Das ist für mich eine genuine Aufgabe von Literatur. Deswegen finde ich, dass die großen literarischen Kunstwerke alle Sachbücher, zum Teil auch wissenschaftlichen Werke und erst recht die journalistischen Publikationen überleben können, weil sie die Breite dieses Blicks haben und das Ereignis insgesamt in einer bestimmten Art und Weise wahrhaftiger darstellen können. Wenn sie groß sind als Literatur, dann sind sie das, weil sie den Blick öffnen, weil sie die Scheuklappen wegnehmen, weil sie beide Seiten darstellen und weil sie wenigstens den Versuch unternehmen, sich aus diesen gesteuerten Verblendungszusammenhängen herauszuarbeiten.
SCHAU INS BLAU: Eine Frage zum Verhältnis der Orientrezeption zur Zeit Goethes — die im Roman ja auch eine gewisse Rolle spielt — und der heutigen Orientrezeption. Spielten Saids Kritik am westlichen Orientbild als kulturelles Konstrukt und die daran anschließenden postkolonialen Studien eine Rolle für die Konzeption des Romans?
THOMAS LEHR: Bei Goethe stellt man eine der früheren Beschäftigungen mit dem Orient fest. Der sogenannte Orientalismus beginnt mit einem kräftigen Missverstehen des Orients, das ist das, was Said klar und plakativ zusammengefasst hat. Ich rekurriere immer darauf, weil der Roman „September” durchzogen ist von einem historischen Grundvergleich: Ich vergleiche die frühere Beherrschung der arabischen Welt durch die europäischen Kolonialmächte und die rezentere Okkupation durch die U.S.A. mit der Szenerie zu Goethes Zeiten, als die vermeintlich fortschrittliche Macht Napoleons ganz Europa überrollte, und lasse die Figuren darüber reflektieren (es gibt einen Satz im Roman, in dem es heißt: „Goethe war Araber”). Goethe hatte ein bestimmtes Bild von Napoleon, das nicht unbedingt richtig war oder sagen wir: nicht frei von Zügen der bloßen Bewunderung der Macht und der vermeintlichen historischer Größe. Ebenso wird das Goethesche Orientbild im Roman ironisch gebrochen. Es gibt Momente, in denen Martin den gesamten Orientkitsch betrachtet, der da aufgehäuft wird, die Musselinkränzchen und das Bajaderen-Lied Mariannes etcetera. Der Orientalismus, der im späteren 19. Jahrhundert noch kitschiger und blümeranter wird, nimmt hier seinen Anfang. Wobei man andererseits auch sagen muss, dass Goethes Beschäftigung auch sehr tiefgehend ist und hauptsächlich über die Sprache erfolgt. Er zieht sich irgendwelche orientalischen Kostümierungen an und dringt gleichzeitig wie kein anderer in die orientalische Dichtung ein.
SCHAU INS BLAU: Sie werfen einen ironischen Blick auf die Figur Goethes und auf den Goethekult, so finden sich in Ihrem Roman Anspielungen auf Thomas Manns „Lotte in Weimar” oder auf Martin Walsers „Ein liebender Mann”.
THOMAS LEHR: „Lotte in Weimar” zitiere ich, denn das hätte Martin gerne gemacht, so was Ähnliches wie Thomas Mann in seinem schönen Roman. Das sind Anklänge für Leute, die belesen sind, die zwischen den Zeilen lesen können. Vielleicht ist es auch Selbstkritik, die dann implizit kommt, weil ich denke, egal wie man das macht, wird in dreißig Jahren jemand die Klischeehaftigkeit oder Borniertheit meiner eigenen Sicht entdecken. Es ging mir darum, zu zeigen, was an Goethes Zugriff einerseits so großartig war und was andererseits lächerlich war, und dass man das eine von dem anderen kaum wird trennen können.
SCHAU INS BLAU: Martin, der Romanprotagonist, schreibt an einem Buch über Goethes Frauen: Im Mittelpunkt steht die Episode mit Marianne von Willemer von 1815, die für die Entstehungsgeschichte des „West-Östlichen Diwans” wichtig werden sollte. Spielt das chiffrierte Liebeszwiegespräch zwischen Hatem und Suleika im „West-Östlichen Diwan” — ein Spiel der Masken und Verwandlungen — für die Schreibweise und Struktur Ihres Romans eine Rolle? Denn auch die Protagonisten Ihres Romans nehmen in monologischen Zwiegesprächen sehr subtil wechselseitig Bezug aufeinander.
THOMAS LEHR: Ja, ich habe einiges aus dem Diwan übernommen: Das eine, Grundlegende, ist das dialogische Prinzip. Als Goethe anfing zu lesen und sich mit dem Thema zu beschäftigen — er begann eigentlich mit der Koranlektüre in frühen Jahren — , schrieb er, dass er sich „produktiv” gegenüber der orientalischen Dichtung verhalten müsse. Er konnte nicht einfach Hafis lesen und absorbieren, wie es ein Leser oder Wissenschaftler getan hätte, sondern er musste selbst in der vorgefundenen Manier dichten. Damit hat er einen Dialog in der Lyrik begonnen. Er zitiert im Diwan sowohl Hafis als auch die Gedichte, von denen wir heute wissen, dass sie von Marianne von Willemer stammen, ohne das kenntlich zu machen. Er fängt also an, ein Werk dialogisch aufzubauen. Dieses dialogische Prinzip war für mich der Urgedanke meines eigenen Buches, so bin ich auf den Dialog als Strukturprinzip gekommen. Ich haben die Figur Tarik erfunden, so wie Goethe sich den Hafis als Partner ausersehen hat. Er hat sich ja selbst Hatem genannt, er hat sich verkleidet, um sich in die andere Kultur zu transportieren. Man könnte denken, dass mein Held Martin etwas Ähnliches macht, indem er unter Umständen seinen Antipoden, Tarik, erfindet. Durch die Verkleidung macht man den ersten Schritt zu einer Art von kultureller Metamorphose und beginnt zu lernen.
SCHAU INS BLAU: Sie sagten, dass zum Produktionsprozess des Romans sehr viele Dialoge mit irakischen Bürgern gehörten. Dieses hat sich niedergeschlagen in Figuren, die ausschließlich innere Monologe führen. Doch das Interessante ist, dass die inneren Monologe immer dialogisch strukturiert sind. Die Figuren reflektieren über die eigene Kultur, aber gleichzeitig auch über die Kultur der Anderen, der (noch) Fremden. Die nur scheinbar paradoxe Simultaneität des Dialogischen im Monologischen scheint mir ein wichtiges Strukturprinzip des Romans zu sein.
THOMAS LEHR: Es ist fast eine philosophische Grundtatsache, die man zum Beispiel auf Hegel zurückführen kann: Die Selbsterkenntnis ist nur im Dialog möglich. Wenn Sie wollen, ist das auch der moralische Tiefgang dieses Buchs, den habe ich auch expliziert in meinen Vorarbeiten, indem ich sagte: Wenn das Buch etwas lehren will, dann ist es das Hegelsche Konzept, dass die Gewinnung der eigenen Subjektivität nur durch die Anerkennung des Anderen möglich ist. Mit dieser Einsicht endet schon „Nabokovs Katze”, und mit dieser Einsicht habe ich auch weiter geschrieben. Die Figuren in „42? haben die Möglichkeit zu diesem Dialog nicht mehr und deshalb wird ihr Leben sinnlos. In „September” ist der Dialog die Voraussetzung der Definition der eigenen Kultur. Es sind fast triviale Erkenntnisse, aber wenn man sie wirklich ernst nimmt und in dem Konflikt der Kulturen beobachtet, erweisen sie sich als substantiell.
SCHAU INS BLAU: Auch in „September” ist — wie in „42? — die erzähltechnische Zeitgestaltung virtuos. Das zentrale Ereignis, der Anschlag auf das World Trade Center, wird erst nach den ersten 140 Seiten geschildert. Doch der Erzählfaden bewegt sich nicht direkt auf das Ereignis zu, sondern enthält viele Vorausdeutungen und Rückblenden sowie ein ständiges Changieren zwischen prospektivem und retrospektivem Erzählen. Wie konzipieren Sie Ihre Texte? Man merkt ihnen an, dass sie bis ins Detail durchkomponiert sind.
THOMAS LEHR: Ich bin kein Autor, der für jeden Abschnitt fünf Fassungen schreibt, ich bin eher jemand, der beim Schreiben denkt. Ich versuche möglichst viel zu planen, das heißt, dass die Struktur möglichst schon von vornherein ausgedacht ist. Ich habe regelrechte Planphasen, in denen ich drei, vier Wochen keine Zeile schreibe, sondern nur Pläne mache. Dadurch kommt auch die Tiefendimension der Struktur zustande. Für mich ist die Architektur eines Romans eine wichtige Arbeit, die ich am Anfang hasste, aber mittlerweile gerne mache. Ich denke mir die Statik eines Buches gerne vorher aus und dann hat es schon in der Anlage die Möglichkeit, raffinierter zu werden. Dann versuche ich beim Schreiben den Prozess selbst auch theoretisch zu fassen und versuche immer wieder Pausen einzulegen, in denen ich das Buch reflektiere. So kommt es zu so einer Verästelung der Struktur, indem ich fast immer versuche, nebenher auch zu denken, wenn ich schreibe. Das verlangsamt manchmal den Schreibprozess, das ist der große Nachteil dabei. Ich kann dann oft zwei, drei Monate lang nicht viel Material erzeugen. Es hat aber den Vorteil, dass ich gar nicht so viele Fassungen benötige. Das Buch entsteht in der ersten Version meistens in der intendierten Komplexität.
Technisch schreibt es sich unterschiedlich. So sind zum Beispiel die Abschnitte im „September”, dieses Alternieren zwischen den Kulturen, später zusammengefügt worden. Da habe ich oft ein ganzes Jahr lang nur auf der einen Seite Szenen geschrieben, und dann auf der anderen Seite, und dann habe ich die Szenen ineinander geschoben. Da ist natürlich auch sehr viel kompositorische Arbeit nötig, und da muss man auch recht viel korrigieren, weil die Teile nicht unbedingt so einfach zusammenpassen.
SCHAU INS BLAU: Zur formalen Konzeption gehört auch, dass der Roman ohne Interpunktion auskommt und die damit einhergehende rhythmische Kühnheit der syntaktischen Konstruktionen, die in Ihrem Werk in dieser Form neuartig sind. Ich nehme an, dass diese mit dem Thema und dem Inhalt eng zusammenhängen.
THOMAS LEHR: Der Ausgangspunkt des Textes war das Betroffensein von dem Anschlag im World Trade Center und von dem sich daraus fast zwangsläufig anbahnenden Irak-Krieg. Dann kam auch ein Erschrecken darüber, dass ich das wohl tatsächlich literarisch angehen würde. Die Form, wie ich das angehen könnte, schien mir nur möglich als möglichst freie, möglichst assoziative oder meditative Art. So schnell nach Ablauf der Ereignisse schon einen großen realistischen Roman zu schreiben, schien mir unmöglich. Ich brauchte einen direkteren Zugang und gleichzeitig auch einen distanzierenden Zugang. Und dann kam diese Vision auf, die im Untertitel des Romans jetzt steht, die der Fata Morgana, der Luftspiegelung. Das beschreibt die Art und Weise, in der sich in meinem Hirn das Ganze abspielte, in der sich diese Ereignisse widerspiegelten. Was ich unternahm, war die Meditation eines Künstlers über ein sehr nahe liegendes, noch gar nicht zu bewältigendes zeitgeschichtliches Thema. So formulierte ich meine künstlerische Idee, die Meditation oder Vision als einzige Art und Weise, das Thema in solcher historischer Nähe anzugehen. Im Widerstreit zu einer bestimmten Art von Journalismus glaube ich überhaupt nicht daran, die Wahrheit fassen zu können, sondern bin voller Skrupel. Als ich dann angefangen hatte, die besondere Sprache des Romans zu entwickeln, eine stark rhythmisierte und zugleich fließende und leuchtende, dialogische Sprache, habe ich allmählich ihre Vorteile und ihren tieferen Sinn erkannt.
SCHAU INS BLAU: Wie ist es, wenn man im Prozess des Schreibens eine solche Paradoxie zu bewältigen hat: Einerseits die Beschreibung der Zerstörungen, der Wut, der Verzweiflung und Enttäuschung der Menschen, des Todes, der an allen Ecken lauert, sei es durch Attentate oder durch den Mangel an Medikamenten, und andererseits Ihre kühnen poetischen Bilder mit überraschenden metaphorischen Wendungen und einer beeindruckenden Musikalität der Sprache, die an manchen Stellen an Celans „Todesfuge” erinnert. Empfinden Sie das als ein Paradox, die Ästhetik des Grauens?
THOMAS LEHR: Der Genitiv wäre falsch. Ich versuche keine Ästhetik des Grauens, sondern ich versuche eine Ästhetik im Grauen. Es wird nämlich in diesem Roman relativ wenig Grauen geschildert. Es gibt wenig Kriegshandlung. Wenn man den Roman anschaut, dann fällt eines auf: Er hat drei Teile und er spielt immer im September: das Jahr 2001, das Jahr 2002 und das Jahr 2004 werden geschildert, ich überspringe das eigentliche Kriegsjahr 2003 und erzähle die Kriegsgräuel dann als Rückblenden, um die Flächen zu minimieren, an denen das eigentliche Grauen überhaupt erzählt wird. Das heißt, ich beschäftige mich gar nicht lang und breit mit der Darstellung von Grauen, auch nicht mit der Ästhetisierung von Grauen. Es ist eher ein Auffinden von sprachlicher Schönheit in einem Thema oder in einer Umwelt, die grauenhaft ist. Ohne dass ich das Grauen so genau schildere, begreift man unwillkürlich den Stress, dem die Menschen im Irak unterworfen sind und dem auch die Angehörigen des Opfers des Attentats auf das World Trade Center ausgesetzt sind. Die Sprache soll man fast als Therapeutikum empfinden, als Möglichkeit, den Dialog zu führen und als Möglichkeit der Verarbeitung des Grauens. Da haben mich auch wieder die literarischen Vorbilder geführt. Mein Vorbild ist Homer. Nun, das wird jeder Schriftsteller sagen, aber man muss ihn auch ernst nehmen, und wenn man Homer ernst nimmt, bei diesem Thema wirklich ernst nimmt, dann lernt man zwei Dinge, die elementar sind. Das eine ist das dialogische Prinzip: Wenn man einen Krieg erzählen will und wenn man ihn fassen möchte, dann muss man beide Seiten darstellen, sowohl die Trojaner als auch die angreifenden Achaier. Und zweitens, dass es möglich ist, das Kriegsgeschehen durch eine sehr streng geformte rhythmische Sprache für den Leser erträglich zu machen. Es ist möglich, in diese Dinge hineinzugehen und sie zu überleben, weil einem diese rhythmisierte und formalisierte Sprache hilft, damit umzugehen. Diese beiden Lehren kann ich direkt auf die „Ilias” zurückführen.
SCHAU INS BLAU: Gleichzeitig ist der Roman eingebettet in weitere grundlegende kulturelle Diskurse auch jenseits Homers: Es gibt unzählige intertextuelle Anspielungen auf die Dichtung Hafis, auf das Gilgamesch-Epos, auf Emily Dickinson oder Walt Whitman. Der Prosatext, selbst in einer überwältigenden poetischen Sprache verfasst, wird durch lyrische Texte unterbrochen, die wie Intarsien einmontiert sind. Welche Funktion haben die lyrischen Texte im Roman? Es scheint mir, als würden sie am Ende jedes einzelnen Abschnitts dessen Quintessenz dialogisch reflektieren.
THOMAS LEHR: Ich war durch den „West-Östlichen Diwan” schon grundiert. Eine der literarischen Folien, von denen ich gelernt habe, mit denen ich in das Thema hineinfand, war eben eine lyrische Quelle, und schon daher lag die Lyrik nahe. Und dann habe ich gelernt, dass die lyrische Form in der arabischen Kultur die höchste Form der sprachlichen Kunst ist und dass die Lyrik den Arabern viel mehr bedeutet als die Prosa. Sie haben hier eine viel größere Tradition. Daher lag das Lyrische nahe und deshalb habe ich auch mit dem lyrischen Zugriff angefangen, dieses dialogische Prinzip zu durchdenken. Ich merkte, dass meine Prosa selbst ohnehin einen grenzlyrischen Gang führt, selbst in Texten, die nicht so gestaltet sind wie „September”. Das gilt auch für meine anderen Texte, das trifft auch für „42? zu. Das heißt, meine Prosa nähert sich in ihrem Bewusstsein und in ihrer Rhythmik ohnehin schon immer der Lyrik, und hier habe ich das einfach weiter fortgesponnen. Zum Teil hat es ganz persönliche Gründe gehabt: Mich hat die Lyrik getröstet bei der jahrelangen Beschäftigung mit Blut und Schrecken. Dann dachte ich, dass Lyrik nicht nur für den Autor ein Trost sein kann, sondern sie tröstet auch die existierenden Menschen, auch die Araber im Krieg. Wenn ein Lyriker in Damaskus zu einer Lyriklesung eingeladen wird, dann kommen 300 Menschen. Die Gedichte werden vorgesungen. Und selbst wenn es den Menschen schlecht geht, hat die Lyrik für sie einen festlichen und sehr wichtigen Charakter. Und dann habe ich gemerkt, dass ich es noch stärker vertiefen musste, denn die Grundstimmen der Völker, das sind eben die lyrischen. Deshalb habe ich Lyrikerstimmen zitiert, die sehr bekannt sind und die den Nationalcharakteren der beiden Völker sehr nahe stehen, die das Wesen dieser Kulturen zum Ausdruck bringen. Diese Stimmen stehen in einem merkwürdigen Dialog miteinander. Wenn man sich damit näher beschäftigt, dann findet man eine Kühnheit bei Emily Dickinson, die auch Abu Nuwas hatte. Das hat mich fasziniert. Es ist, als wäre der Dialog schon da, in der Lyrik. Dann wird zum Beispiel auch Adonis zitiert. Adonis hat leidenschaftlich Walt Whitman gelesen. Dieser Dialog findet statt, in den Köpfen der lebenden Lyriker zum Beispiel.
SCHAU INS BLAU: Es ist umso wichtiger, auf diese Form des kulturellen Dialogs in der Literatur hinzuweisen, als die einseitige Diagnose Huntingtons vom Kampf der Kulturen den medialen Diskurs viel zu lang beherrscht hat. Wenn man einem solchen Roman und seinen zugrunde liegenden Prätexten nachgeht, dann merkt man, dass es nur eine Seite der Medaille ist, und dass es viel mehr Korrespondenzen und Berührungen, gibt, auf die Sie hinweisen.
THOMAS LEHR: Mir kam es schon darauf an, und das habe ich sehr schnell gelernt, dass die Ähnlichkeiten größer sind als die Unterschiede. Man muss die Ähnlichkeiten nur erkennen wollen, dann gibt es sehr viele Möglichkeiten, Dialoge zu führen. Es gibt einige drastische Unterschiede, aber die sind nicht derart, dass nicht ein sehr gedeihliches Miteinander möglich wäre.
SCHAU INS BLAU: Sie hatten in einem früheren Interview gesagt, dass Ihnen bei der Konzeption des Romanes „42? die Verquickung komplexer naturwissenschaftlicher Theorien und philosophischer Themen mit einer anspruchsvollen poetischen Sprache zunächst als eine Zumutung an den Leser, danach der einzig gangbare Weg erschien. Die formale Konstruktion in „September” scheint mir noch kühner zu sein, durch die fehlende Interpunktion und durch den Verscharakter mancher Prosazeilen. Einzelne Wörter im Satz werden betont, indem sie — wie Verse — isoliert in einzelnen Textzeilen stehen und durch Enjambements an poetischem Gewicht gewinnen. Die herkömmlichen Gattungsgrenzen zwischen Lyrik und Prosa scheinen aufgehoben zu sein. So merkt man mit jedem neu erschienenen Roman eine Entwicklung des Stils und das permanente Ringen um neue poetische Ausdrucksformen. Haben Sie den Anspruch, für jede neue Geschichte oder neue Thematik eine neue poetische Form zu finden, so dass Inhalt und Form ineinander verschmelzen?
THOMAS LEHR: Wenn es eine durchgängige Charakteristik meines Schreibens gibt, dann ist es sicherlich die, dass ich mit jedem Thema die Form suche. Ein Buch entsteht bei mir dann, wenn dieser Zusammenklang gegeben ist. Viele meiner Bücher sind noch nicht entstanden, weil dieser Zusammenklang noch nicht möglich war. Ich werde vom Thema getrieben: Das erste, was ich habe, ist die thematische Idee, und dann beginnt eigentlich die Suche, wie ich sie sprachlich realisieren kann. Wenn ich die Antwort auf diese Frage habe, entsteht das Buch oder es entsteht nicht. Es muss ein maximales Gefühl von Kohärenz geben. Das ist eine ästhetische und eigentlich sehr sinnliche Sache, damit das Buch mir wert scheint, geschrieben zu werden, oder damit ich es überhaupt bewältigen kann und es aushalte, mich mit diesem Buch jahrelang zu beschäftigen. Das kann ich nur, wenn ich eine sehr schöne Form finde.
SCHAU INS BLAU: Herr Lehr, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren zukünftigen Projekten, auf die wir uns jetzt schon freuen, und den Lesern unserer Zeitschrift viel Freude bei der Lektüre Ihres Buches.

Thomas Lehr wurde 1957 in Speyer geboren. Er studierte Biochemie in Berlin und ist dort als freier Schriftsteller tätig. Seine Werke – Zweiwasser oder Die Bibliothek der Gnade. Roman (1993), Die Erhörung. Roman (1994), Nabokovs Katze. Roman (1999), Frühling. Novelle (2001), 42. Roman (2005) – wurden mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet, u. a. mit dem Literatur-Förderpreis Berlin, dem Rheingau Literatur Preis, dem Wolfgang-Koeppen-Preis der Hansestadt Greifswald und dem Kunstpreis des Landes Rheinland-Pfalz.
Am 18. August 2010 ist Thomas Lehrs Roman „September. Fata Morgana“ im Hanser Verlag erschienen. Er wurde für den Deutschen Buchpreis 2010 nominiert.