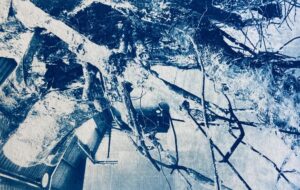Guido Gin Koster brennt für das literarische Hörspiel. Keine andere Gattung eigne sich besser, um die Gratwanderung zwischen Unterhaltung und Bildung ohne plumpen Moralismus zu meistern. Doch ist das Hörspiel nicht schon längst tot? Ein Gespräch über eine scheinbar verlorene Kunst, Vorurteile und: Geld.
Schau ins Blau: Warum sollte man heute noch Hörspiele hören?
Guido Gin Koster: Ich glaube, der Bildungsaspekt wird häufig unterschätzt. In meinen Hörspielen geht es zum Beispiel oft um historische Themen. Nach der Ausstrahlung von „Jerusalem. Desafinado“ sprach mich eine Hörerin an und sagte, dass es wirklich toll sei, auf eine so angenehme Weise mehr über das heutige Jerusalem zu erfahren. So soll es sein.
Wieso eignet sich dafür das Hörspiel besonders gut?
Ich versuche immer, Erkenntnisse über Themen zu verarbeiten, die mir besonders am Herzen liegen — und das am besten auf einem bestimmten Niveau. Das Hörspiel kann unterhalten und bilden und ist dabei nicht zu lang und nicht zu kurz. Welche andere Gattung haben wir denn sonst dafür? Im Theater funktioniert das für mich analog komischerweise nicht.
Wollen Sie mit Ihren Hörspielen auch moralisieren?
Der Münchner Intendant Matthias Lilienthal hat einmal gesagt: „Gute Sozialarbeit ist immer noch besser als schlechtes Theater“. Das unterschreibe ich auch fürs Hörspiel. Es hat überhaupt keinen Zweck, die Hörer zu belehren und sie für dumm zu verkaufen. Trotzdem möchte ich, dass meine Hörspiele nicht nur unterhalten, sondern auch Impulse geben. Ich habe den pädagogischen Anspruch, mich zu fragen: „Was sind Themen, die eine Gesellschaft bewegen?“
Macht es dabei einen Unterschied, ob Sie ein Hörspiel oder einen Roman schreiben?
Der größte Unterschied für mich ist, dass ich beim Hörspiel immer komprimieren muss — worunter ich manchmal leide. Ich weiß dann, ich habe nur eine bestimmte Anzahl an Zeichen oder Minuten und somit keinen Platz, manches weiterzuentwickeln. Ich weiß auch, dass die Chance, ein Stück vom Sender produzieren zu lassen umso größer ist, je weniger Figuren es gibt. Drei bis vier Figuren sind gut, acht bis zehn eher weniger. Dann überlegt man als Autor natürlich schon: Wie kann ich jetzt den Text so gestalten, dass ich nur 50.000 Zeichen brauche? Prosa ist dann schon eine nette Abwechslung, da hat man Zeit und Platz. Ansonsten finde ich die Unterschiede nicht so groß.
Wie hat sich Ihr Weg zum Hörspiel gestaltet?
Ich bin aus mehreren Gründen beim Hörspiel gelandet. Zum einen war es am Anfang ein finanzieller Anreiz, da meine ersten Theaterstücke nur an kleineren Häusern inszeniert wurden. Zum anderen habe ich aber schnell gemerkt, dass ich so für die Bühne ‚üben’ kann. Ich habe vier oder fünf Hörspiele geschrieben, aus denen später Theaterstücke wurden. Zum Beispiel ‚Nachklang’. Und für die Bühnenfassung habe ich dann 1996 den damals gerade wieder ‚aktivierten’ Kleist-Dramatiker-Preis erhalten. Damals habe ich auch Regieanweisungen für meine Hörspiele geschrieben, als wären es Bühnenanweisungen für Regie und Ausstattung! Heute würde ich sagen: überflüssigerweise. Und schließlich bin ich mit dem Hörspiel aufgewachsen. Meine Mutter war eine große Anhängerin des Hörspiels und als Kind habe ich immer sehr viele Hörspiele (mit)gehört.
Obwohl es doch bestimmt auch bei Ihnen zu Hause einen Fernseher gab?
Zuhören hat mir gereicht. Wenn es ein gutes Hörspiel war, konnte ich die Bilder sofort sehen. Außerdem hatte es auch etwas Verbotenes. Einige Filme durfte ich nicht sehen, dann habe ich immer ab der Tagesschauzeit heimlich Hörspiele gehört. Ich sollte aber eigentlich im Bett noch lesen und nicht am Radio hängen. Und beim Hören war ich ungemein fasziniert von den Sprechern. Ich reagiere sehr auf Stimmen. Das hängt sicher auch mit meiner musikalischen Ausbildung zusammen.
Sie haben Hörspiele sowohl für Kinder als auch Erwachsene geschrieben. Auf welchen Markt möchten Sie sich in Zukunft fokussieren?
Ich habe mir vorgenommen, wieder mehr Stücke für Menschen meines Alters zu schreiben, denn da ist gerade eine Leerstelle. Das Hörspiel ist momentan sehr zweigeteilt: in akustische Experimente einerseits und in Umsetzungen von Jugendtexten, Krimis oder erfolgreichen Romanen andererseits. Ich plädiere aber für Originaltexte, die für das jeweilige Medium geschrieben werden. Seien es Texte für die Bühne oder für das Hörspiel. Ich würde also gerne Texte für Menschen zwischen 40 und 60 Jahren schreiben. Meine Generation sehe ich da momentan unterrepräsentiert. Aber das ist schwierig, weil weder die Hörspieldramaturgen noch die Theaterdramaturgen wirklich darauf eingestellt sind und viel Zeit und Mühe auf ‚Bearbeitungen’ verwenden. Daher kommt heute auch eine gewisse Begriffsverwirrung, was das Hörspiel vom Hörbuch unterscheidet.
Welche Themen haben Sie bei dieser Zielgruppe im Kopf?
Letztendlich will man immer bei seinen eigenen Themen bleiben, also biografische Themen, die sich im Laufe der Jahre angesammelt haben. Bei Hörspielen habe ich in den letzten Jahren zudem auch politische Themen wie die Shoa aufgegriffen. Ich habe mir vorgenommen, zukünftig auch aktuelle Themen zu Israel zu machen. Die Redaktionen sind diesbezüglich aber mehr als zurückhaltend und sagen oft ab. ‚Jerusalem.Desafinado’ zum Beispiel wurde von allen Redaktionen der ARD, ORF und SFR abgesagt. Nur der kleine RBB hat sich getraut und gesagt: Wir machen das!
Bekommen Sie zu den Absagen auch Begründungen?
Bei ‚Jerusalem.Desafinado’ fühlten sich anscheinend viele Radiodramaturgen herausgefordert, ihre Absage zu begründen. Sonst hat sich heute leider das Prinzip ‚Daumenhoch-Daumen runter’ durchgesetzt. Ohne dass man noch einen Dreizeiler dazu erhält.
Manche Begründungen — was jetzt dieses Hörspiel zum gegenwärtigen Israel betrifft — streiften Antisemitismus. Ein Redakteur sagte mir zum Beispiel, er könne das nicht machen, denn er habe keine Schauspieler, die wie Juden klingen. Dann habe ich gefragt: Wie klingen denn Juden? Aber natürlich will ich die Antwort nicht wirklich hören. Ein deutscher Schauspieler, der jüdisch ist, klingt natürlich wie Sie und ich. Vielleicht hat er einen leichten bayerischen oder hessischen Akzent oder sonst etwas. Ein anderes Mal hatte ich eine Geschichte über ein gleichgeschlechtliches Paar. Diese Geschichte, in der auch noch eine Vergewaltigung vorkam, musste ich dann auf ein heterosexuelles Paar umschreiben, weil das Radiopublikum, nach Meinung des Redakteurs, eher konservativer sei. So etwas nenne ich Zensur. Aber wenn Sie einen gewissen ökonomischen Druck haben, machen Sie das. Natürlich knicken sie als Autor dann ein, denn sie wollen ja von ihrer Arbeit leben.
Welche Freiheiten hat man als Hörspielautor, was die Themen betrifft? Oder gibt es so etwas wie Auftragsarbeiten zu speziellen, vorher vereinbarten Themen?
Bis Mitte der 80er Jahre gab es Auftragsarbeiten, aber dafür bin ich dann doch eine jüngere Generation. Das habe ich selber nicht mehr erlebt, seit ich 1990 mein erstes Hörspiel unterbringen konnte. Übrigens damals mit George Tabori als Sprecher! Für DDR-Autoren gab es das noch länger, weil sie sonst nach der Wende oft vor dem Nichts gestanden wären. Also soweit ich weiß, hat die Kulturwelle des DDR Rundfunks oft Auftragshörspiele vergeben. Und wie mir Kollegen erzählten: mit erstaunlich großen Freiheiten. Wahrscheinlich dachten die damals ‚Mächtigen’ auch: Wer hört schon Hörspiele?
Ich schreibe schon immer für alle möglichen Redaktionen — und zwar ausschließlich auf eigenes Risiko. Manchmal brauche ich drei Monate, mal ein Dreivierteljahr, um einen größeren Hörspieltext fertigzustellen. Das hängt ja auch von der Recherche ab. Sehr aufwendig war da eine Hörspielarbeit über eine Kriegsfotografin. Sich mit Kriegsfotografie zu beschäftigen, das dauert natürlich seine Zeit. Das wurde dann auch eine Arbeit, die mich auch emotional sehr mitgenommen hat. ‚Am Anfang war der Blick’. Eine große Produktion des NDR Hamburg. Der Redakteur war ein feingeistiger Mensch, der auch mein erfolgreichstes Hörspiel ‚Was für eine schöne Reise’ produziert. Was ‚Hörspiel des Monats’ wurde und bis heute immer wieder von den Sendern ins Programm genommen wird. Eine ‚Shoa-Geschichte’, mit der ich auch nach Israel eingeladen wurde zu einer öffentlichen Vorführung und danach mit den Menschen gesprochen habe, die es direkt betroffen hat. Das sind immer sehr emotionale Begegnungen.
Arbeiten Sie an mehreren Projekten gleichzeitig oder konzentrieren Sie sich immer nur auf eine Arbeit?
Ich habe versucht, parallel zu arbeiten, aber das schaffe ich kaum. Ich muss immer einen Text fertigstellen, bevor ich etwas Neues anfangen kann. Finanziell gesehen ist das natürlich eine Katastrophe. Leichter ist es mit Radiofeature, die ich ja auch mache. Aber das ist mehr eine … Sacharbeit. Da sind dann anscheinend weniger die Emotionen beschäftigt.
Was muss ein Autor im Jahr leisten, um von der Arbeit leben zu können?
Man müsste an drei bis vier Hörspielen gleichzeitig arbeiten, um finanziell hinzukommen. Wir Autoren leben nicht so sehr von den Neuproduktionen, sondern von den sogenannten Übernahmen. Also Wiederholungen. Übernahmen werden mit zwischen 25 und 75 Prozent von dem honoriert, was man ursprünglich für eine Neuproduktion eines Hörspiels bekommen hat. Wenn man ehrlich ist, kann man aber seit Ende der 2000er nicht mehr davon so leben, dass man mit diesen Einnahmen auch eine Familie ernähren könnte. Für ein Hörspiel bekommt man um die 4000 Euro. Wenn Sie gut sind, bekommen Sie zwei bis drei im Jahr produziert.
Wo sehen Sie das Problem?
Die Sender haben viel weniger Termine für die Ausstrahlung von Hörspielen als früher. Die Zahl der Autoren bleibt aber ungefähr gleich. Grob geschätzt konkurrieren also 200 Autoren um Sendeplätze, die sich seit 10 Jahren um etwa 30 Prozent dezimiert haben. Die Sender müssten überlegen, dass sie im Jahr nur noch so viele Stücke produzieren, wie es dafür auch Sendeplätze gibt. Momentan produzieren sie aber noch so viele, als hätten sie noch Sendeplätze wie in der alten Hochzeit des Radios zur Verfügung. Dadurch sind aber die Wiederholungsplätze durch Ursendungen blockiert, denn die Ursendungen müssen ja laut Vertrag einmal gesendet werden. Zudem kommt natürlich auch, dass seit einigen Jahren versucht wird, das Honorar zu drücken. Die Verlage haben ‚Mindesthonorare’ durchgesetzt, was aber zu der absurden Situation geführt hat, dass auch nicht mehr als die Mindesthonorare gezahlt werden, auch wenn vorher die ‚freiwilligen’ Honorare der Sender höher lagen. Ein gesellschaftliches Phänomen überhaupt. Wer Mindestlohn zahlen muss, zahlt eben auch nicht mehr als das. Wir Autoren sind meistens in keiner guten Verhandlungsposition, unter anderem deswegen, weil wir meistens nicht gewerkschaftlich organisiert sind. Die ARD verhandelt gerade mit Verlagen neue Honorarbedingungen aus und da wollen sie jetzt hineinschreiben lassen, dass diese Bedingungen nur noch für die gelten, die in einer Gewerkschaft organisiert sind. Das ist natürlich unmöglich. Autoren sind keine Stahlarbeiter oder Krankenschwestern. Wir tun uns mit Gewerkschaften eben schwerer.
Was müsste Ihrer Meinung nach im Hörspielbereich geschehen?
Also wir Autoren sollten uns nicht dafür entschuldigen, dass wir Hörspiele machen. Da sind wir zu sehr in eine Defensive gedrängt worden. Es existiert ein Publikum, das Interesse an Hörspielen hat. Das sehe ich ja immer, wenn die Sender vor der Ausstrahlung im Radio zu einer öffentlichen Präsentation des Hörspiels einladen. Da ist man oft erstaunt, wie viel Menschen kommen, um nur in einem Saal zu sitzen und eine Stunde lang auf zwei große, schwarze Lautsprecher zu starren. Also da gibt es richtige Freaks, die sich auch in der Hörspielgeschichte sehr gut auskennen. Also mehr als ich auf jeden Fall! Also dieses Interesse, muss wieder mehr anerkannt werden. Ich bekam zum Beispiel am Anfang meiner Hörspielkarriere noch Besprechungen meiner Sachen in der FAZ oder in der Süddeutschen Zeitung. Diese Rubriken gibt es auch schon länger nicht mehr. Das heißt, man arbeitet etwas in einem luftleeren Raum. Ohne große Resonanzen. Und da haben sich die Hörspielredaktionen in eine passive und defensive Position hineinmanövriert. Ich hoffe, das wird sich ändern. Die Redakteurinnen und Redakteure sind ja jetzt jünger als ich und werden auch neue Verbreitungskanäle nutzen. Also sicher mehr als die alte Riege, die jetzt so nach und nach abtritt.
Wie arbeiten Sie als Autor? Wie beginnen Sie Ihre Schreibarbeit?
Das Wichtigste ist: Sie müssen Anfang und Ende kennen. Dann schreibe ich Blöcke, die einem Filmskript ähneln. Ich schreibe nicht mehr chronologisch. Vielleicht, weil ich älter werde und ich mich schlechter konzentrieren kann, wer weiß… Was ich aber brauche, ist Logik, also ein Gerüst im Kopf. Wenn ich merke, dass ich abschweife, setze ich manchmal aus und frage mich, ob ich mich gerade von… Tageseingebungen verführen lasse. Bei Texten fürs Kinderhörspiel bin ich befreiter. Weil sie nicht logisch in unserem erwachsenen Sinn sein müssen. Um jemanden von A nach B zu bekommen, kann ich einen fliegenden Teppich einbauen. Das geht bei den Texten für die Erwachsenen leider nicht. Da muss ständig eine Logik beachtet werden, die eben auch einengend ist.
Was hilft Ihnen beim Schreiben? Schreiben Sie immer am selben Schreibtisch oder haben Sie gewisse Rituale?
Nein. Ich kann immer und überall schreiben, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich brauche auch keine Abgeschiedenheit, ich lasse mich auch nicht durch Menschen um mich herum ablenken. Aber: Ich brauche immer Musik, die zum Thema passt und mich in Stimmung versetzt.
Haben Sie beim Verfassen der Hörspiele schon eine Idee von der Vertonung im Kopf?
Ja, und das kann ich während des Schreibens auch nicht verdrängen. Zum einen läuft das Schreiben erst richtig gut, wenn ich weiß, welche Musik ich als Regisseur verwenden würde. Aber leider sind ja meistens Autorschaft und Regie in der ARD streng getrennt. Zum anderen habe ich die Stimmen der Sprecherinnen und Sprecher beim Schreiben schon im Kopf. Ich weiß dann: Dieser Schauspieler ist ein eher älterer, knorziger Typ und der wird es auch auf diese Art im Studio einsprechen. Also betone ich die Rolle auch in diese Richtung. Man braucht manchmal Stereotypen. Früher nannte man das ‚die komische Alte’ oder der ‚aufbrausende Jüngling’. Sonst funktioniert es auch für die Hörer zu Hause nicht. Ein Hörspiel ist ja doch kurz. Eine knappe Stunde. Bilder im Kopf entwickeln ist gut und schön, aber es ist eine Hilfestellung, wenn Klischees auf positive Art und Weise auch über die Stimmen erfüllt werden. Dass man die Hörspiele jetzt danach über Mediatheken zum Nachhören abrufen kann, war ja noch vor wenigen Jahren technisch gar nicht möglich. Leider hinkt das sogenannte Vergütungssystem der Technik hinterher. Was wir Autoren dafür bekommen, dass die Hörfunkanstalten die Hörspiele im Netz einstellen, bis zu einem Jahr, ist ein Witz. Also da muss ein neues Bezahlsystem her. Ich weiß nicht, vielleicht pro Klick soundsoviel. Und solange es im Netz zum kostenlosen Nachhören steht, bekommt man ja auch keine honorierte Übernahmen durch andere Sender hin. Wozu sollten sie, wenn man es sowieso umsonst im Netz abrufen kann.
Wann halten Sie eine Umsetzung für misslungen?
Hauptkriterium für mich ist die Musikalität. Wenn der Sprecher einen anderen Rhythmus spricht als ich mir das vorstelle, dann ist das – für mich — schlecht. Die Hörer können es natürlich total anders empfinden. Es kann auch passieren, dass Sprecher nicht meine Art von Humor teilen, Ironie nicht erkennen und dann alles sehr ernst sprechen. Das ist vor allem bei Texten über die Shoa oder den Holocaust so. Ich will aber keinen deutschen Gedenktags-Ton haben.
Wie erkennen Sie, dass ein Sprecher zu Ihrem Text passt?
Sprecher sollen den Text sprechen und nicht bloß ablesen! Noch besser ist es, wenn sie ihn im Studio spielen. Also auswendig. Sobald sie am Text kleben und die ganze Zeit auf die Blätter vor ihnen starren, ist es vorbei. Ich finde es zum Beispiel eine großartige Form der Zusammenarbeit, wenn mich vor der Aufnahme im Studio Sprecher anrufen, weil sie sich unsicher sind, wie sie manche Stellen einsprechen sollen. Für mich ist die Musikalität besonders wichtig und wenn ein Sprecher sagt, dass er einen Satz, so wie ich ihn geschrieben habe, nicht sprechen kann, dann akzeptiere ich das immer. Von den Telefonaten mit Schauspielern habe ich als Schreiber immer profitiert. Es muss ihnen leicht von der Zunge gehen.
Werden Sie von der Umsetzung Ihrer Texte eher positiv oder negativ überrascht?
Meistens positiv. Erstaunlich, was? Die Hörspielproduktion ist grundsätzlich recht demokratisch. Man erlaubt mir in vielen Fällen auch ein Mitspracherecht. Ich kann zum Beispiel sagen, dass ich gerne diese oder jene Sprecher hätte. Man hat natürlich Lieblingsschauspielerinnen und Schauspieler, die einem besonders gut gefallen. Und auch bei der Musikfarbe kann ich Vorschläge machen. Das ist natürlich für mich, weil ich ja auch von der Musik her komme, besonders wichtig. Und selbst die Vorschläge für die Regie werden beachtet. Es muss natürlich zeitlich passen. Und wenn jemand mit meinen Texten gar nichts zu tun haben wollte, dann haben mir das die Dramaturgen meistens diskret verschwiegen. Deswegen weiß ich gar nicht, welche Regisseure meine Texte grauenvoll finden!
In Ihrem Hörspiel „Jerusalem. Desafinado“ behandeln Sie die Thematik jüdischer Identität und Kultur auf humoristische Weise. Wie schaffen Sie es, belastete Stoffe wie diese humorvoll umzusetzen?
Humor ist mir gegeben. Im Fall von „Jerusalem. Desafinado“ kam zudem meine eigene Geschichte hinzu. Zum einen habe ich zwei prägende Großmütter, eine war sehr katholisch, und die andere ist in einer jüdischen Familie aufgewachsen, die dann nach Brasilien in die Emigration gingen. Zum anderen haben meine eigene Familie und ich selber für einige Zeit in Jerusalem gelebt und wir sind auch jedes Jahr wenigstens einmal in Israel. Für dieses Hörspiel habe ich wie ein Journalist gearbeitet. Ich bin mit einem Block rumgelaufen und habe aufgeschrieben, was ich so aufgeschnappt habe. Vor allem in Supermärkten und auf Spielplätzen sieht und hört man viel. Eigentlich ein normales Miteinander. Da erzählen mir dann muslimische oder christliche Palästinenser, dass ihre Familien seit Jahrhunderten schon neben Familien „anderen Glaubens“ leben und es hat immer funktioniert. Aber dann stülpt sich so oft diese große Politik drüber, die das Miteinander in der Nachbarschaft nicht zulässt. Da merkt man schnell: Es gibt bestimmte Probleme in Israel, die die Politiker brauchen, um an der Macht zu bleiben. Und das ist dann doch eine immer wieder deprimierende Erfahrung. Aber ich sage dann immer: Wir in Berlin haben nicht geglaubt, dass die Mauer fällt. Und auch ihr in Israel werdet euer 1989 bekommen.

Susanne Heinrich wurde 1985 bei Leipzig geboren. Sie verfasste schon in ihrer Schulzeit literarische Texte und studierte zeitweise am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Zwischen 2005 und 2011 erhielt sie Aufenthalts-Stipendien in Berlin, Los Angeles und der Villa Massimo in Rom. In diesen Jahren veröffentliche sie zwei Romane und zwei Bände Erzählungen.
Ab 2012 studiert sie Regie an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin. Mit Das melancholische Mädchen erschien 2019 ihr erster Film, der von der Kritik vielfach begeistert aufgenommen wurde und bisher mit dem Max-Ophüls-Preis und dem Drei-Länder-Filmpreis der Sächsischen Kunstministerin für den besten Spielfilm ausgezeichnet wurde.