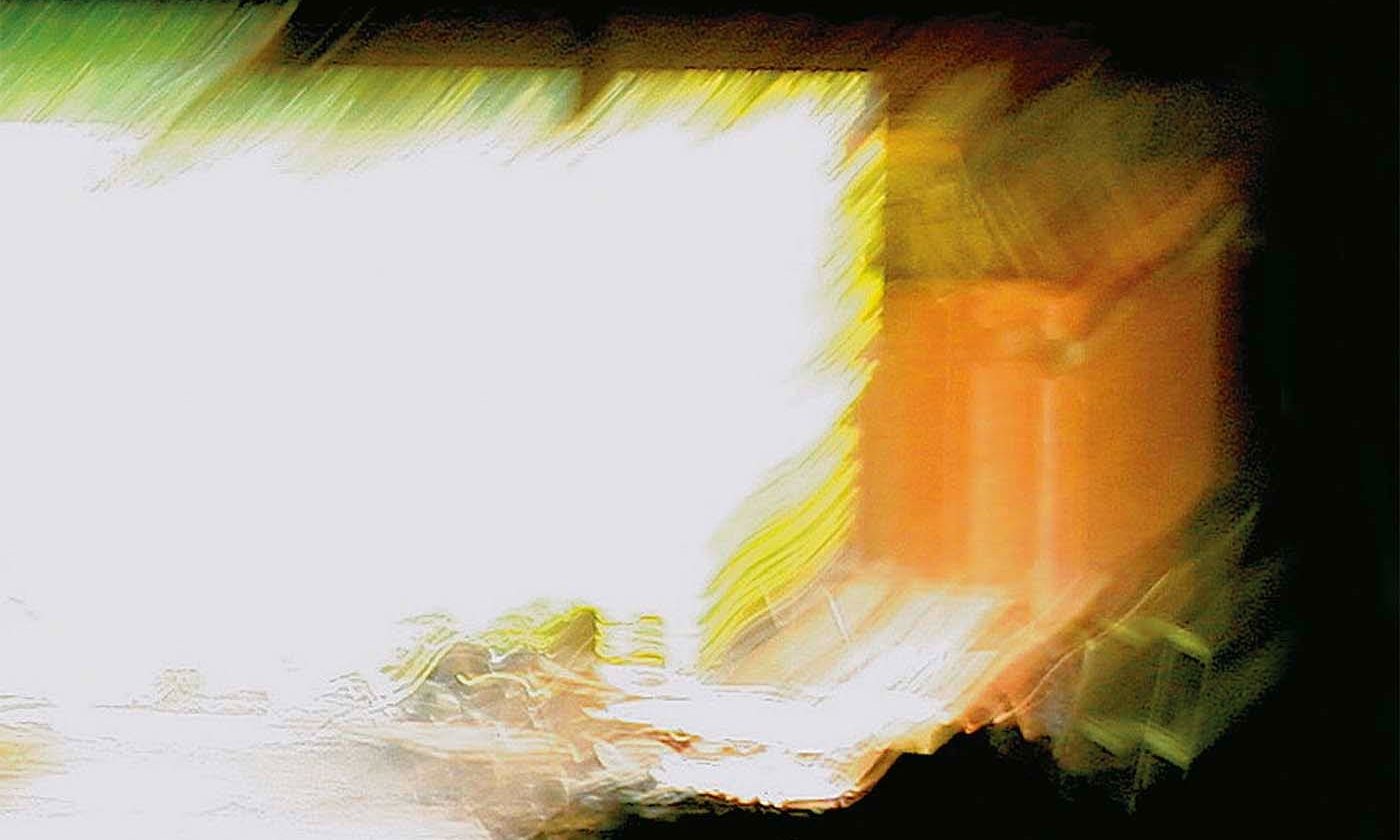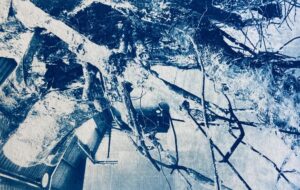Michel Houellebecq ist derzeit der große Star der französischen Literaturszene und zieht seit Jahren höchstes Interesse von Publikum und Kritik auf sich und sein Werk. Die im Zentrum seines Schaffens stehenden Romane sind dabei vor allem wegen ihrer oft krassen Darstellung der zeitgenössischen Realität und der aktuellen Situation der westlichen Gesellschaft umstritten, aber Houellebecq beschäftigt sich nicht nur ausgiebig mit unserer Gegenwart, sondern zeichnet in zwei seiner Romane auch ein Bild der Zukunft, die er für die Menschheit erwartet. Erstmals skizziert Houellebecq eine solche Zukunftswelt in seinem bekanntesten Roman,
Les particules élémentaires (1998), der seinen endgültigen Durchbruch bedeutete und ihm internationalen Ruhm einbrachte. In seinem jüngsten großen Werk,
La possibilité d’une île (2005), nimmt er dieses Thema erneut auf und behandelt es weitaus ausführlicher, wobei er eine klar anti-utopische Zukunft ersinnt und dadurch einer Literaturgattung, die in Frankreich zu ihrer ersten konkreten Ausprägung kam, neue Kraft einzuflößen vermag; diese fiktive Zukunftswelt Houellebecqs samt ihrer Verknüpfung zur Gegenwart und zur literarischen Tradition soll in diesem Beitrag behandelt werden. In
Les particules élémentaires stellt Houellebecq die Zukunftsgesellschaft nur knapp in einem Prolog und einem Epilog dar, die die eigentliche Handlung, welche in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts angesiedelt ist, umschließen. In dieser Rahmenerzählung erfährt der Leser, dass eine neue menschliche Spezies entwickelt wurde, die auf einem veränderten genetischen Code basiert, der sie einerseits unsterblich macht und andererseits vom sexuellen Verlangen befreit hat. Durch diese Beseitigung jeder sexuellen Begierde soll die neue Menschheit zum Glück geführt werden — dies war die Grundüberlegung des Wissenschaftlers Michel Djerzinski, der Hauptfigur des Romans. Dass die natürliche Menschheit keinerlei Aussichten auf ein glückliches Leben hatte, wird anhand der Lebensgeschichten von Michel und seinem Halbbruder Bruno verdeutlicht. Diese beiden Lebensläufe bilden die Binnenerzählung, und beide Biographien sind voller Scheußlichkeiten und Enttäuschungen. Die beiden Halbbrüder erleiden eine schlimme Erfahrung nach der anderen und sind vor allem nicht in der Lage, eine funktionierende Liebesbeziehung aufzubauen. Erst sehr spät finden sie Partnerinnen, die jedoch ähnlich frustrierende Lebensverläufe hinter sich haben und nach neuerlichen Schicksalsschlägen Selbstmord begehen und Michel und Bruno wieder allein zurücklassen. Die Erlebnisse der beiden Brüder zeigen aber nicht nur zwei gescheiterte Lebensentwürfe, sondern — und hierin liegt eine der großen Stärken des Romans — bilden eine Generalkritik an der westlichen Zivilisation an der Schwelle zum 21. Jahrhundert: Houellebecq offenbart hier die ?Gesellschaftsdiagnose eines katastrophalen Niedergangs des Humanum in allen Bereichen” (Schober 2001, S. 189). Michel nimmt sein enttäuschendes Leben zum Ausgangspunkt für seine wissenschaftliche Arbeit, die die Menschheit endgültig von ihrer unbefriedigenden Existenz befreien soll, wobei er eine Grundidee seines Autors vertritt, der überzeugt ist, dass es der Drang nach Individualisierung ist, der die Menschen in ihr Unglück stürzt (vgl. auch Spiller 2004, S. 216f.). Michel setzt diese Erkenntnis in wissenschaftliche Ergebnisse um und kann eine genetische Formel schaffen, die die neuen Menschen von sexueller Begierde und dem Wunsch nach Individualität befreit. Nach der Veröffentlichung seiner Ergebnisse begeht Michel Selbstmord, da er in seinem weiteren Leben keinen Sinn mehr sieht. Seine Forschungsergebnisse werden begeistert aufgenommen und immer weiter entwickelt, so dass 2029 der erste künstliche Mensch geschaffen werden kann. Schnell setzen sich die neuen Menschen durch, und als im Jahre 2079 der den Roman beschließende Epilog verfasst wird, gibt es fast nur noch künstlich entstandene Menschen, während die letzten Vertreter der alten Spezies nahezu ausgestorben sind. Die Zukunftsmenschen kennen keinen Leid, aber auch keine echten Gefühle mehr, weshalb sie an die ebenfalls künstlich erzeugten Menschen von Huxleys
Brave New World erinnern, was auch alles andere als ein Zufall ist: Huxleys Anti-Utopie ist der ?spezifische Intertext” von
Les particules élémentaires (Pöppel 2006, S. 64). Dies wird von Houellebecq auch in aller Deutlichkeit herausgestellt, denn nahezu exakt in der Textmitte steht ein Dialog von Michel und Bruno über
Brave New World, der als zentraler Teil des Romans zu sehen ist. Interessanterweise sehen die beiden Halbbrüder die von Huxley dystopisch erdachte Welt positiv-utopisch und lesen den Engländer damit gegen den Strich. Dies ist durch ihre zutiefst negativen Erfahrungen in unserer Gegenwart zu erklären, die ihnen eine Welt à la Huxley erstrebenswert erscheinen lassen, wie Bruno ihn einem fast schon hymnischen Lob für diese fiktive Welt ausführt:
La société décrite par
Brave New World est une société heureuse, dont ont disparu la tragédie et les sentiments extrêmes. La liberté sexuelle y est totale, plus rien n’y fait obstacle à l’épanouissement et au plaisir. […] C’est exactement le monde auquel aujourd’hui nous aspirons, le monde dans lequel, aujourd’hui, nous souhaiterions vivre. Je sais bien […] qu’on décrit en général l’univers d’Huxley comme un cauchemar totalitaire, qu’on essaie de faire passer ce livre pour une dénonciation virulente ; c’est une hypocrisie pure et simple. Sur tous les points — contrôle génétique, liberté sexuelle, lutte contre le vieillissement, civilisations des loisirs,
Brave New World est pour nous un paradis. (Houellebecq 1998, S. 195f.)
Diese Meinung wird von Michel geteilt, dessen Urteil den englischen Autor wohl überrascht hätte (Houellebecq 1998, S. 199): ?Aldous Huxley était un optimiste.” Letztlich nützt Michel auch Huxleys Überzeugung, dass die Biologie die entscheidende Veränderung der Menschen herbeiführen werde, denn durch seinen neuen genetischen Code wird eine Menschheit möglich, die zu der Huxleys erstaunliche Parallelen aufweist. Diese positive Wertung von
Brave New World gepaart mit den schrecklichen Ereignissen in den Leben von Michel und Bruno scheint darauf hinzudeuten, dass die von Houellebecq ersonnene und Huxleys Entwurf ähnelnde Zukunftsgesellschaft positiv zu sehen ist. Dies wird auch in der einschlägigen Sekundärliteratur oft so gesehen: So spricht Roland Spiller (2004, S. 220) von der ?tröstende[n] Welt der Utopie”, und Hubert Pöppel (2006, S. 65) sieht das Ende mit den neuen Menschen als ?Rettung und Hoffnung”. Aber trotz dieser Wertungen hinterlässt der Schluss von
Les particules élémentaires ob der aseptisch wirkenden neuen Menschheit einen unbehaglichen Eindruck beim Leser, und so kann man dem Urteil von Rita Schober (2001, S. 207) folgen, die feststellt, dass man diese Zukunftspassage ?verschieden lesen [kann], als Chance für die Menschheit, aber auch als Warnung”. Norbert Niemann (2001, S. 88) spricht von der ?beunruhigenden Ambivalenz des Schlusses” und trifft damit aus meiner Sicht den Kern, denn letztlich ist das Romanende nicht klar zu deuten und gibt den Lesern die Möglichkeit zu eigenen Wertungen, die ganz unterschiedlich ausfallen können. Ist die Haltung Houellebecqs zur Zukunft in
Les particules élémentaires also noch unentschieden, so erfährt sie in seinem neuesten Werk eine eindeutige Präzisierung hin zum Negativen: In dem sieben Jahre nach seinem großen Bestseller abgeschlossenen jüngsten Roman
La possibilité d’une île konkretisiert Houellebecq die damals nur ihm Rahmen angedeutete Zukunft — und nun treten deren furchterregenden Aspekte in aller Deutlichkeit zutage und lassen keinerlei Interpretationsspielraum mehr. Man kann
La possibilité d’une île in vielerlei Hinsicht als Verlängerung und Ausgestaltung der in
Les particules élémentaires angedachten Ideen zur kommenden Menschheit sehen, was schon daran deutlich wird, dass wiederum eine Verschränkung zwischen Gegenwart und Zukunft stattfindet, die Zukunftspassagen nun aber viel breiteren Raum einnehmen und die Zukunft zudem auch eine fernere ist: War der Epilog von
Les particules élémentaires 2079 angesiedelt, so dringt
La possibilité d’une île bis etwa ins Jahr 4000 vor. In dieser fernen Zukunft gibt es wie in
Les particules élémentaires zwei klar getrennte Menschheitsformen: Natürliche Menschen, die — auch das eine Analogie zum ersten Zukunftsroman — am Aussterben sind, sowie eine neue Menschheit, deren Mitglieder durch das in dieser Zukunft technisch mögliche Klonen entstehen und sich selbst
néo-humains nennen. Diese
néo-humains blicken auf unsere Gegenwart zurück, wobei das Verfahren der Verschränkung von Zukunft und Gegenwart gegenüber
Les particules élémentaires wesentlich erweitert ist. Die Zukunftsmenschen haben nun nicht mehr nur in Prolog und Epilog das Wort, sondern in jedem zweiten Kapitel: Der Roman besteht aus dem Lebensbericht von Daniel1 sowie zugehörigen Kommentaren von seinen Klonen Daniel24 und Daniel25, wobei sich Bericht und Kommentar fortwährend abwechseln. Daniel1 lebt in unserer Gegenwart und wird zu Beginn des 21. Jahrhunderts Mitglied einer Sekte, der es gelingt, ihren Mitgliedern eine Art Unsterblichkeit zu ermöglichen, indem sie ihre DNS speichert und sie nach ihrem Tod durch Klone ersetzt. Diese Klone sterben auch nach einer gewissen Zeit, werden aber stets nahtlos durch einen neuen Klon ersetzt, so dass das Erbgut des Ausgangsmenschen bis in die Ewigkeit erhalten bleibt. Jeder Klon erhält den Namen des Vorgängers sowie eine Nummer, die anzeigt, um die wievielte Austauschung des Originalmenschen es sich handelt. Die wichtigste Tätigkeit der Klone besteht in der Kommentierung der Lebensberichte ihres natürlichen Vorgängers, wodurch die beschriebene Romanstruktur und die Verklammerung von Gegenwart und Zukunft erreicht werden. Im Lebensbericht von Daniel1 findet sich die aus
Les particules élémentaires und den anderen Romanen Houellebecqs bekannte Kritik an der westlichen Zivilisation, indem der Protagonist in seiner Niederschrift den gravierenden Werteverfall unserer Gesellschaft enthüllt. Daniel begeht schließlich Selbstmord, womit seine Lebensgeschichte eine wichtige Parallele zu derjenigen von Michel aufweist. Die Selbstmorde der Hauptfiguren beider Romane unterstreichen den negativen Befund über die in ihnen beschriebene Gesellschaft der westlichen Hemisphäre: Für Houellebecqs Charaktere ist diese Umwelt so bedrückend, dass sie Selbstmord als einzigen Ausweg ansehen. Der Lebensbericht von Daniel1 ist aber nur ein Teil des Romans, während der andere — und ebenso bedeutende — von den Kommentaren der Klone gebildet wird, wobei zunächst Daniel24 das Leben seines Vorläufers kommentiert und nach dessen Tod Daniel25 dieses Werk fortsetzt. In den Anmerkungen der Klone finden sich nicht nur Gedanken über unsere Gegenwart, sondern auch viele Hinweise zum Leben in der Zukunft — und letzteres wird im Laufe des Romans immer wichtiger wie auch die Abschnitte der Klone immer ausführlicher werden: Zunächst sind die Kommentare der
néo-humains nur kurze Einlassungen, am Ende aber tritt der Lebensbericht von Daniel1 vollständig hinter den Bericht von Daniel25 zurück. Der Klon beschränkt sich nicht mehr auf Bemerkungen zum Leben seines Vorgängers, sondern führt ein echtes eigenes Tagebuch: Die abschließenden 50 Seiten des Romans werden einzig durch die letzten Aufzeichnungen von Daniel25 gebildet, der sich auf eine Reise gemacht hat, deren Ereignisse er erzählt, während von Daniel1 keine Rede mehr ist, womit der Roman gänzlich in der Zukunft angekommen ist. Der Leser blickt in diesem neuesten Roman Houellebecqs in eine schreckenerregende Zukunftswelt, in der zunächst eine Verwüstung der Erde durch Atombomben und Naturkatastrophen zu konstatieren ist. In dieser zerstörten Welt leben nur noch wenige Menschen, die sich auf natürliche Art fortpflanzen, und eine ebenfalls kleine Anzahl von
néo-humains. Letztere wurden im Laufe der Zeit genetisch weiter entwickelt: Ihre DNS wurde im Hinblick auf die Energieversorgung verändert, so dass sie keine Nahrung mehr benötigen und allein durch die Einnahme von Wasser und bestimmten Salzen überleben können. Durch diese Veränderungen bilden die
néo-humains letztlich eine neue Spezies: Es ist zu einer ?coupure définitive entre les néo-humains et leurs ancêtres” gekommen (Houellebecq 2005, S. 365). Im Prinzip sollen die
néo-humains eine verbesserte und vor allem glücklichere Version der Menschen des 20. Jahrhunderts darstellen, aber gerade in dem entscheidenden zweiten Punkt scheitert dieses Vorhaben, denn die
néo-humains sind in keiner Weise glücklicher als wir — und darauf wird zurückzukommen sein. Zunächst sei aber die zweite Rasse dieser Zukunftswelt vorgestellt, die letzten Überlebenden der natürlichen Menschen. Diese sind durch Kriege und klimatische Veränderungen vollkommen degeneriert und auf einen Zustand zurückgeworfen, der etwa dem der Steinzeit entspricht. Jede Kultur und jede Zivilisation sind verloren gegangen, so dass diese letzten Menschen unter barbarischen Bräuchen leben und einzig dem Recht des Stärkeren gehorchen. Ständig kommt es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen unter ihnen, ohne dass sich dabei irgendwer um die Verletzten und Sterbenden kümmert:
Parfois ils se jettent l’un sur l’autre, s’affrontent, se blessent par leurs coups. […] Progressivement ils se détachent du groupe, leur démarche se ralentit, ils tombent sur le dos. […] Des insectes et des oiseaux se posent sur la surface de chair nue, offerte au ciel, la picotent el la dévorent ; les créatures souffrent encore un peu, puis s’immobilisent. Les autres, à quelques pas, continuent leurs luttes et leurs ménages. Ils approchent de temps à autre pour assister à l’agonie de leurs compagnons ; leur regard à ces moments n’exprime qu’une curiosité vide. (Houellebecq 2005, S. 54f.)
Unsere Nachkommen sind vollständig vertiert, und den Gipfelpunkt des zivilisatorischen Niedergangs bildet die Tatsache, dass sie sogar die Sprache verloren haben (Houellebecq 2005, 338: ?Rien n’indiquait cependant qu’ils aient pu […] accéder de nouveau au langage.”). Aufgrund dieses erbarmungswürdigen Zustands werden sie von den
néo-humains nur als ?sauvages” bezeichnet — ja, die Klonmenschen betrachten sie schlicht als Tiere, wie Daniel24 unmissverständlich klar macht (Houellebecq 2005, S. 26): ?Je les [les hommes] considère justement comme des singes un peu plus intelligents.” Die
néo-humains haben sich gar die Auslöschung der natürlichen Menschen zum Ziel gesetzt (Houellebecq 2005, S. 438): ?[La petite commune néo-humaine] n’avait nullement pour objectif de préparer une résurrection future de l’humanité, mais au contraire de favoriser, dans toute la mesure du possible, son extinction.” Dazu töten sie immer wieder Menschen, die ihren Häusern zu nahe kommen, was sie problemlos tun können, da sie ihnen in jeder Hinsicht turmhoch überlegen sind. Die
néo-humains verfügen nämlich im Gegensatz zu den degenerierten Resten der natürlichen Menschheit über eine technisch hoch entwickelte Zivilisation mit vielen modernen Hilfsmitteln, die uns noch gänzlich unbekannt sind. Doch diese technische Fortentwicklung kaschiert nur auf den ersten Blick eine Existenz, aus der alles verschwunden ist, was das menschliche Leben lebenswert macht. Beim Lesen der Lebensberichte ihrer natürlichen Vorläufer merken die
néo-humains fortwährend, dass sie zu vielen zentralen Eigenschaften der alten Menschheit überhaupt nicht mehr fähig sind (Houellebecq 2005, S. 77): ?La bonté, la compassion, la fidélité, l’altruisme demeurent […] près de nous comme des mystères impénétrables.” Unsere wichtigsten positiven Eigenschaften existieren in der Gesellschaft der
néo-humains nicht mehr, und diese haben sich so weit von unseren Gefühlen entfernt, dass sie nicht einmal mehr zu den elementarsten Äußerungen des Empfindens, nämlich Lachen und Weinen, in der Lage sind:
Etant génétiquement issu de Daniel1 j’ai bien entendu les mêmes traits, le même visage ; la plupart de nos mimiques, même, sont semblables (quoique les miennes, vivant dans un environnement non social, soient naturellement plus limitées) ; mais cette subite distorsion expressive, accompagnée de gloussements caractéristiques, qu’il appelait le
rire, il m’est impossible de l’imiter ; il m’est même impossible d’en imaginer le mécanisme. Les notes de mes prédécesseurs, de Daniel2 à Daniel23, témoignent en gros la même incompréhension. Daniel2 et Daniel3 s’affirment encore capables de reproduire le phénomène, sous l’influence de certaines liqueurs ; mais pour Daniel4 déjà, il s’agit d’une réalité inaccessible. Plusieurs travaux ont été produits sur la disparition du rire chez les néo-humains ; tous s’accordent à reconnaître qu’elle fut rapide. Une évolution analogue, quoique plus lente, a pu être observée pour les
larmes, autre trait caractéristique de l’espèce humaine. (Houellebecq 2005, S. 61f. (Kursivierung im Original))
Am schwersten wiegt allerdings, dass diese künstlichen Menschen den Zustand des Glücks nicht kennen und so trotz aller technischen Fortschritte sogar ihre Hunde beneiden (Houellebecq 2005, S. 76): ?Sa nature [celle du chien] en elle-même inclut la possibilité du bonheur. Je ne suis qu’un néo-humain, et ma nature n’inclut aucune possibilité de cet ordre.” Damit wirkt das Leben der Klone noch deutlich schlimmer als die schrecklichen Ereignisse im Leben von Daniel1, die ein Spiegelbild der Katastrophen sind, die Michel und Bruno in
Les particules élémentaires erleben müssen. Andreas Woyke (2006) stellt dies treffend heraus:
Das von Liebesverlangen und aggressiver Egomanie zerrissene Leben von Daniel 1 erscheint uns erbärmlich, aber es birgt doch ernsthafte Glücksmomente und wache Erkenntnismotive, das eintönige Leben von Daniel 25 und sein oberflächlich-abgeklärtes Wesen sind aber noch weit erbärmlicher und entbehren letztlich all das, was ein ganzheitlich verstandenes Menschsein ausmacht.
Von wahrem Leben kann hier kaum noch die Rede sein, es handelt sich um eine bloße Existenz, und dieser Befund wird noch dadurch verstärkt, dass die
néo-humains völlig isoliert voneinander in hermetisch abgeriegelten festungsähnlichen Häusern wohnen und nur selten per E‑Mail mit anderen
néo-humains kommunizieren, während sie körperlichen Kontakt allein mit ihren — ebenfalls geklonten — Hunden kennen. Jahrhundertelang lebten die Klone widerspruchslos unter diesen Bedingungen, doch allmählich setzt ein Wandel ein, der im Roman an Daniel25 dargestellt wird: Dieser glaubt, dass es eine Insel geben müsse, auf der ein erfüllteres Leben möglich ist, und bricht auf, diese zu finden. Er beschließt, aus seinem sicheren Bereich auszubrechen und Neues zu wagen, da ihm seine bisherige Existenz zunehmend unerträglich geworden ist (Houellebecq 2005, S. 429): ?Cette routine solitaire, uniquement entrecoupée d’échanges intellectuels, qui avait constitué ma vie, qui aurait dû la constituer jusqu’au bout, m’apparaissait à présent insoutenable.” Daniel25 verlässt gemeinsam mit seinem Klon-Hund Fox zum ersten Mal in seinem Leben seine abgeschirmte Behausung in der Nähe des südspanischen Almería und begibt sich in die freie Natur. Er berichtet ausführlich von der nun folgenden Reise, die das Bild vervollständigt, das der Leser von den
néo-humains und den Nachfolgern der natürlichen Menschen bis dahin schon gewonnen hat. Zunächst scheinen die neue Freiheit und der Kontakt mit der Natur Daniel25 gut zu tun, und er erlangt erstmals wichtige menschliche Fähigkeiten. So ist er als erster
néo-humain seit ewigen Zeiten wieder zu Tränen in der Lage (Houellebecq 2005, S. 431): ?Vinrent les larmes, aussi, dont le contact salé me parut bien étrange.” Außerdem versteht er nun zumindest im Ansatz, was Liebe bedeutet — ein Gefühl, das den
néo-humains bis dahin vollständig unverständlich geblieben war und dessen Bedeutung Daniel25 nun zu ahnen beginnt, wenn auch nur im Bezug auf seinen Hund:
Malgré ma lecture attentive de la narration de Daniel1 je n’avais toujours pas totalement compris ce que les hommes entendaient par
l’amour, je n’avais pas saisi l’intégralité des sens qu’ils donnaient à ce terme ; […] A l’issue pourtant de ces quelques semaines de voyage dans les sierras de l’intérieur de l’Espagne jamais je ne m’étais senti aussi près d’aimer. (Houellebecq 2005, S. 439 (Kursivierung im Original))
Durch diese Veränderungen ist für Daniel25 — wohl zum ersten Mal im Leben eines
néo-humain überhaupt — zu einem wahren Glücksgefühl fähig (Houellebecq 2005, S. 439): ?J’étais heureux.” Aber dieses Glücksgefühl bleibt nur eine kurze Episode ohne Folgen, die von den weiteren Stationen der Reise zum unbedeutenden Zwischenspiel degradiert wird. Daniel25 richtet sich während des feuchten Herbstes in einem verlassenen Schloss ein und hat da mehrere Wochen lang die Gelegenheit, die dort lebenden natürlichen Menschen genau zu beobachten, wobei sich deren Wertung als ?sauvages” als vollkommen zutreffend erweist. Unsere natürlichen Nachfahren sind zu keinerlei produktiven Tätigkeiten mehr fähig und leben in einer äußerst brutalen Gemeinschaft zusammen, in der blutrünstige Exzesse und selbst Kannibalentum an der Tagesordnung sind. Spätestens jetzt ist Daniels Urteil unverrückbar:
Je savais que j’avais affaire à des êtres néfastes, malheureux et cruels ; ce n’est pas au milieu d’eux que je trouverais l’amour, ou sa possibilité, ni aucun des idéaux qui avaient pu alimenter les rêveries de nos prédécesseurs humains ; ils n’étaient que le résidu caricatural des pires tendances de l’humanité ordinaire. (Houellebecq 2005, S. 451)
Das Leben unserer Nachkommen hat nichts menschenwürdiges mehr und gestattet keinerlei Aussicht auf ein erfülltes Dasein — aber auch die Existenz der
néo-humains bietet keine Alternative, wie Daniel25 immer klarer wird. Der Tod seines Hundes Fox, der von den ?sauvages” durch Pfeile getötet wird, trennt ihn vom einzigen Lebewesen, das ihm zumindest ein wenig etwas bedeutet hat, und wenig später muss er sich eingestehen, dass auch sein Ausbruch aus der gewohnten Lebensweise — trotz der allzu kurzen Phase relativer Zufriedenheit in den ersten Tagen der Reise — nicht zu einem glücklichen Leben geführt hat (Houellebecq 2005, S. 471): ?J’étais [..] très loin de la joie, et même de la véritable paix ; le seul fait d’exister est déjà un malheur.” Er beschließt schließlich, den Rest seines Lebens in einer vollkommen zerstörten und vegetationslosen Natur an der Küste des Ozeans zu verbringen, wobei seine letzte Aussage das Dilemma der
néo-humains in aller Deutlichkeit verrät (Houellebecq 2005, S. 474): ?Le bonheur n’était pas un horizon possible.” Die genormte und aseptische Existenz der Klone ist genauso wenig eine wünschenswerte Lebensform wie die vertierte Gemeinschaft der natürlichen Nachkommen der Menschheit — ein erfülltes Leben ist in beiden Fällen unmöglich und echtes Glück ausgeschlossen. Houellebecqs Roman endet somit in auswegloser Düsternis: Der französische Autor sieht für die Zukunft der Menschheit nur die Wahl zwischen Pest und Cholera, zwischen der seelenlosen Gefühllosigkeit der
néo-humains und der absoluten Degenerierung der natürlichen Menschen. Dieser Befund führt uns zum Titel des Romans, der von höchster Bedeutung ist:
La possibilité d’une île bezeichnet nämlich nur vordergründig die Suche von Daniel25 nach einer neuen Lebensform, wichtiger aber ist, dass dieser Titel auf eine klare Verbindung zu Huxley hinweist. Wie oben gezeigt, ist
Brave New World der Intertext zu
Les particules élémentaires — und einen ähnlichen Bezug gibt es zwischen einem weiteren Roman Huxleys und
La possibilité d’une île. Wie Huxley im 1946 verfassten nachträglichen Vorwort zu
Brave New World feststellte, sah er es als Schwäche seines Romans an, dass der Held nur zwischen zwei gleichermaßen unbefriedigenden Alternativen wählen konnte, nämlich dem menschenunwürdigen Leben ohne jede Kultur in den Reservaten der Wilden und dem moralisch und seelisch verkümmerten Leben der hochtechnisierten Welt:
It seems worth while at least to mention the most serious defect of the story, which is this. The Savage is offered only two alternatives, an insane life in Utopia, or the life of an primitive in an Indian village, a life more human in some respects, but in others hardly less queer and abnormal. […] To-day I feel no wish to demonstrate that sanity is impossible. (Huxley 1958, S. viif.)
Rund fünfzehn Jahre nach diesem Vorwort will Huxley mit
Island (1962) den zuletzt erwähnten dritten Weg darstellen, ein Leben in ?sanity”, das dem Protagonisten von
Brave New World noch verwehrt blieb. Mit
Island schafft Huxley eine positive Utopie, die den Pessimismus von
Brave New World relativiert und der Menschheit eine glückliche Zukunft möglich erscheinen lässt (vgl. auch Guardamagna 2000, S. 318), auch wenn das beschriebene Paradies in der Gegenwart angesiedelt ist. Genau diese optimistische Lösung ist aber für Michel Houellebecq keine Option für die Menschheit, und man geht wohl nicht zu weit, wenn man den Titel seines Romans, der Huxleys Titel aufgreift, auch auf die positive Utopie des Engländers bezieht: Houellebecq verneint die ?possibilité” von
Island entschieden — in seiner Zukunft gibt es nur die beiden Optionen, die Huxley in
Brave New World dargestellt hatte und zwar in einer gegenüber dem Original noch weiter verschärften Form: Der Mensch kann für seine Zukunft nur zwischen einem Leben auf zivilisatorisch niedrigstem Niveau oder einer materiell erfüllten, aber seelisch verarmten roboterähnlichen Existenz ohne all das, was menschliches Leben ausmacht, wählen. Eine dritte Option besteht laut Houellebecq nicht, denn es gibt sie eben nicht die ?possibilité d’une île”. Es bestehen also enge Verbindungen zwischen Houellebecqs beiden Zukunftsromanen und Huxleys (anti-)utopischen Schriften: Huxleys Werk ist ein entscheidender Bezugspunkt für das literarische Schaffen von Michel Houellebecq, der sich in
Les particules élémentaires mit
Brave New World und in
La possibilité d’une île mit
Island auseinandersetzt. Ganz bewusst beschäftigt sich Houellebecq mit dem wichtigsten Autor, der im 20. Jahrhundert sowohl eine Utopie wie auch eine Anti-Utopie geschrieben hat, — und er deutet dabei zunächst die Anti-Utopie positiv um (in
Les particules élémentaires) und verwirft später die Utopie (in
La possibilité d’une île). In beiden Fällen bezieht Houellebecq also klar Stellung für eine pessimistische Lösung, und den Hoffnungsschimmer, den Huxley seinen Lesern mit
Island gewährt, weist er entschieden zurück. Huxleys Kosmos wird von Houellebecq einzig in die negative Richtung gedeutet, womit dieser keinen Zweifel daran lässt, dass er eine schreckliche Zukunft für die Menschheit erwartet. So stellt sich der wichtigste französische zeitgenössische Autor in die Tradition der Anti-Utopie, einer Gattung, die ihren Ursprung in Frankreich hatte und nun mit
La possibilité d’une île mit Macht in ihr Geburtsland zurückkehrt. Bis heute wird die Anti-Utopie noch immer zu selten als eigenständige Gattung wahrgenommen und zu oft nur in ihrem Verhältnis zur positiven Schwestergattung beschrieben, so dass eine umfassende Gattungsgeschichte bis heute ein Desiderat der Forschung ist. Ebenso fehlt bislang eine in jeder Hinsicht überzeugende Begriffsbestimmung der Anti-Utopie, die man in Anlehnung an die ausgesprochen gelungene Definition der positiven Utopie durch Trousson (1999, S. 24) als die mittels einer literarischen Erzählung erfolgende Beschreibung einer Gesellschaft bezeichnen könnte, die die Komplexität der sozialen Wirklichkeit abbildet und sich dabei als in der Zukunft situierte Höllenwelt erweist, welche vor unreflektierten Fortschrittshoffnungen sowie vor bestimmten, aus Sicht des Autors bedrohlichen, Tendenzen der zeitgenössischen Gegenwart warnen und den Leser so zum Handeln auffordern will. Ein entscheidendes Kriterium für die Anti-Utopie ist die zeitliche Situierung der fiktiven Situierung, da nur so der dem Genre inhärente Aufforderungscharakter möglich ist. Örtlich verlegte Schreckensgesellschaften, die bis zum Ende des 18. Jahrhunderts gelegentlich auftauchen, sind daher lediglich als Vorläuferformen der Anti-Utopie zu werten. Als Höhepunkt dieser anti-utopischen Vorformen muss man wohl Swifts
Gulliver’s Travels bezeichnen, wobei die auf der vierten und letzten Reise Gullivers beschriebenen Yahoos bemerkenswerte Parallelen zu den natürlichen Nachkommen von uns Menschen in
La possibilité d’une île aufweisen: In beiden Fällen wird eine steinzeitähnliche, allein auf dem Recht des Stärkeren basierende Gemeinschaft vertierter Wesen präsentiert, die nur noch entfernt an Menschen erinnern und von einer überlegenen Rasse (bei Swift den weisen Pferden, bei Houellebecq den
néo-humains) als wilde Tiere angesehen werden, die es auszulöschen gilt. Die echte Anti-Utopie wird in der Mitte des 19. Jahrhunderts erreicht, als Emile Souvestre mit
Le monde tel qu’il sera (1845/46) erstmals eine negative Gesellschaft in die Zukunft projiziert, die damit drohend auf uns zukommt, wodurch der Aufforderungscharakter in der Anti-Utopie verankert wird, die sich damit als eigenständiges Genre etabliert (vgl. Trousson 2000, S. 182f.). Doch nicht nur die erste Ausprägung der Anti-Utopie, sondern auch zentrale Weiterentwicklungen der Gattung wurden im Anschluss an Souvestre in Frankreich geleistet, was von der Forschung bisher zu wenig beachtet wurde. Von besonderer Bedeutung ist dabei Jules Vernes Frühwerk
Paris au XXe siècle, das zu Anfang der 1860er Jahre geschrieben wurde, nach der Ablehnung durch seinen Verleger Hetzel aber zu Vernes Lebzeiten nie erschien und erst 1994 publiziert wurde. In diesem — literarisch leider wenig überzeugenden — Werk wird bereits die uns wohl bekannte Formel der großen Anti-Utopien des 20. Jahrhunderts verwendet mit einem direkten Einstieg in der Zukunftswelt ohne Rahmen und einem am Ende scheiternden Außenseiter als Helden, während Souvestre formal noch der klassischen positiven Utopie mit Rahmenhandlung und einem (Zeit-)Reisenden als Protagonist gefolgt war. Mit Souvestre und Verne erreicht die Anti-Utopie einen ersten und heute weitgehend vergessenen Höhepunkt im Frankreich des 19. Jahrhunderts, bei dem die wesentlichen formalen wie auch inhaltlichen Elemente der berühmten Texte des 20. Jahrhunderts bereits vorweggenommen werden. Allerdings übernehmen ab den 1920er Jahren andere Nationalliteraturen die führende Rolle in diesem Bereich, und nachdem Jewgenij Samjatin mit
Wir kurz nach dem Ersten Weltkrieg endgültig das Paradigma der modernen Anti-Utopie geschaffen hat, sind es insbesondere angelsächsische Autoren, die das Genre kultivieren, wobei neben dem bereits mehrfach erwähnten Huxley insbesondere an George Orwell zu denken ist, dessen Roman
1984 bis heute das landläufige Bild der literarischen Anti-Utopie prägt. Auf die beiden Engländer folgen amerikanische Autoren wie Kurt Vonnegut (
Player Piano) oder Ray Bradbury (
Fahrenheit 451), während in Frankreich nach den Weltkriegen einzig die Werke von Pierre Boulle (
La planète des singes,
Les jeux de l’esprit) noch bedeutendere Versuche in dieser Gattung darstellen. Allerdings war zuletzt nicht nur in Frankreich eine Schwäche des anti-utopischen Genres zu beobachten, sondern die Gattung insgesamt schien sich totzulaufen, als sich nach den großen Anti-Utopien der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die immer gleichen Inhalte und Strukturen zu wiederholen schienen, ohne dass neue Ideen und Formen eingebracht wurden:
This invention was limited. Positive utopia had walked along the same streets and repeated the dreams of happiness constructed with identical models. Dystopia found the same difficulties of bringing itself up to date after Zamyatin, Huxley and Orwell had defined its paradigms. Fifty years later, writers described the same obsessions and terrors of a threatening future. (Trousson 2000, S. 184)
Nun ist aber Michel Houellebecq mit
La possibilité d’une île erstmals wieder eine bedeutende Anti-Utopie gelungen, die der Gattung neue Impulse vermitteln kann und sie zudem nach langer Abwesenheit wieder in die französische Literatur zurückkehren lässt. Dabei stellt Houellebecq eine Grundüberzeugung ins Zentrum seiner Überlegungen, die schon die frühesten französischen Beispiele der Anti-Utopie geprägt hatte: Die Diskrepanz zwischen technischem Fortschritt und moralischer Dekadenz. Souvestre und Verne beobachteten den enormen wissenschaftlichen Fortschritt des 19. Jahrhunderts mit Sorge, weil sie ihn von ethischer Degenerierung begleitet sahen. Diese Fehlentwicklung einer Gesellschaft, die sich auf wissenschaftlich-technischem Gebiet fortwährend weiterentwickelte, im Bereich der Moral aber Rückschritte verzeichnete, überzeichneten die französischen Anti-Utopisten des 19. Jahrhunderts in ihren Werken und stellten so unmenschliche Zukunftswelten dar, um vor den ihnen bedrohlich erscheinenden Tendenzen ihrer Gegenwart zu warnen. Michel Houellebecq geht denselben Weg, da er in
La possibilité d’une île einerseits den technischen Fortschritt unserer Zeit klar herausstellt (vor allem indem er die Möglichkeit des Klonens in seinem Roman erfolgreich auf den Menschen überträgt) und gleichzeitig den aus seiner Sicht frappierenden Niedergang der Sitten plastisch darstellt, was im Lebensbericht von Daniel1 seinen Niederschlag findet. Durch die enge Verschränkung von Beschreibung unserer Gegenwart im Lebensbericht des ersten Daniel und Beschreibung der drohenden Zukunft in den Einlassungen seiner Klone, gelingt es Houellebecq zudem ausgezeichnet zu verdeutlichen, welche Fehlentwicklungen in der Gegenwart ein solches Horrorszenario für die Zukunft erwarten lassen. Seine Verknüpfung vom Jetzt mit dem Später zeigt sich als besonders wirkungsvoll, um beunruhigende Tendenzen und ihre drohenden Konsequenzen darzustellen, wodurch sich die von ihm gewählte literarische Form für die Gattung der Anti-Utopie als ausgesprochen fruchtbar erweist. Möglicherweise kann
La possibilité d’une île deshalb als Vorbild einer neuen Welle anti-utopischer Texte dienen, was bei der Bekanntheit seines Autors wie vor allem der aktuellen eher negativ geprägten Zukunftssicht unserer Gesellschaft nicht überraschen würde. Doch trotz dieser weit verbreiteten Zukunftssorge bleibt die Hoffnung, dass unseren Nachkommen eine weitere Möglichkeit zu den zwei von Houellebecq evozierten offen steht und sie dem Wunsche Huxleys gemäß ein Leben in ?sanity” führen können — kurz, dass die ?Möglichkeit einer Insel” doch nicht verneint werden muss.
Bibliographie
Primärwerke
- Houellebecq, Michel, 1998,
Les particules élémentaires, Paris. - Houellebecq, Michel, 2005,
La possibilité d’une île, Paris. - Huxley, Aldous, 1958,
Brave New World, London. - Huxley, Aldous, 1972,
Island, London.
Sekundärliteratur
- Guardamagna, Daniela, 2000, ?
Island”, in: Trousson, Raymond; Fortunati, Vita (Hg.),
Dictionary of literary utopias, Paris, 317–320. - Niemann, Norbert, 2001, ?Korrekturen an der Schönen Neuen Welt”, in: Steinfeld, Thomas (Hg.),
Das Phänomen Houellebecq, Köln, 82–90. - Pöppel, Hubert, 2006, ?Das Klonen von Menschen in den Zeiten des Menschenparks: Utopie und Anti-Utopie bei Joao Ubaldo Ribeiro (
O sorriso do lagarto) und Michel Houellebecq (
Les particules élémentaires)”, in:
ABP. Jahrbuch zur portugiesischsprachigen Welt: Lusophone Literaturen und Kulturen im Kontakt, 63–75. - Schober, Rita, 2001, ?Weltsicht und Realismus in Michel Houellebecqs utopischem Roman
Les particules élémentaires”, in:
RZLG 25, 177–211. - Spiller, Roland, 2004, ?Sex, Lust und Depression. Michel Houellebecqs Kult elementarer Energien”, in: Freiburg, Rudolf; May, Markus; Spiller, Roland (Hg.),
Kultbücher, Würzburg, 201–221. - Trousson, Raymond, 1999,
Voyages aux pays de nulle part. Histoire littéraire de la pensée utopique, Brüssel, 3. Auflage. - Trousson, Raymond, 2000, ?Dystopia”, in: Trousson, Raymond; Fortunati, Vita (Hg.),
Dictionary of literary utopias, Paris, 180–185. - Woyke, Andreas, 2006, ??Melancholische Sinnsuche’ und ?sozio-technologische Machbarkeitsphantasien’ bei Michel Houellebecq — Folie für die Bewertung aktueller Zukunftsperspektiven?”, in:
Sic et Non. Zeitschrift für Philosophie und Kunst. Im Netz 6, (
bei sicetnon.org).