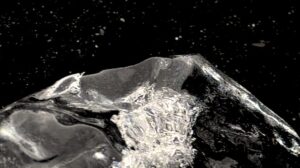Ein Gespräch mit Harald Lesch über Moral & Ethik
von Janina Müller und Melanie Gerstenlauer
Für Immanuel Kant war klar: Der bestirnte Himmel über uns und das moralische Gesetz in uns macht die Würde des Menschen aus. Doch hätte Kant gewusst, dass der bestirnte Himmel über ihm die Voraussetzung ist, dass es ihn und seine Moralvorstellungen überhaupt gibt, er zu 92% aus Sternenstaub besteht, hätte er den bestirnten Himmel bestimmt weggelassen. Denn das moralische Gesetz in uns macht unsere Würde aus, das Universum schweigt zur Moral. Das ist die Überzeugung von Astrophysiker und Naturphilosoph Harald Lesch. Schau ins Blau hat ihn zu einem Interview in der Sternwarte in München getroffen, um über Moral und Ethik, Metaphern und Wahrheitsanspruch in der Astrophysik zu sprechen.
SCHAU INS BLAU: Sie kennen ja mit Sicherheit das berühmte Zitat von Immanuel Kant: „Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir.“ Sie selbst schreiben in ihrem Buch Weißt du, wie viel Sterne stehn: „Erst gelebte Moral macht den Homo sapiens zum Menschen.“ Einige Absätze später dann aber: „Kann man sich ein moralisches Gesetz bei höher entwickelten Tieren noch vorstellen, so ginge es wohl zu weit, wollte man von ihnen auch eine gewisse Ehrfurcht beim Anblick des nächtlichen Sternenhimmels erwarten.“ Was bedeutet es für den Menschen also, den Blick in den Himmel zu richten?
HARALD LESCH: Das finde ich lustig, weil ich gerade einen Text verfasse für ein Buch über die Milchstraße, wo ich genau darüber etwas geschrieben habe. Wir können uns das heute ja kaum noch vorstellen, was es bedeutet…
Diejenigen, die schon einmal in der Wüste waren und einen Sternenhimmel gesehen haben, der wirklich dunkel ist, die können sich vorstellen, was Menschen gefühlt haben müssen, wenn sie früher unter freiem Himmel diese Sternensaat da oben gesehen haben. Es ist ein Rätsel – es ist auch für uns Astronomen eigentlich immer noch ein Rätsel, denn wir wissen zwar inzwischen, das bei den Lichterchen da oben nicht einfach „Gott die Fenster offen gelassen hat“, sondern wir wissen: Es handelt sich um Gasbälle, die unter ihrem eigenen Gewicht zusammengefallen sind und in ihrem Innern passieren irgendwelche merkwürdigen Kernreaktionen.
Und trotzdem ist es so, dass die Frage danach, was das alles soll, dadurch nicht beantwortet wird. Das heißt: Der Himmel ist eine einzige Frage an uns – oder in uns. Und das tönt schon in uns seit es überhaupt Menschen gibt, die irgendwelche Artefakte hinterlassen haben. Ob das nun die Scheibe von Nebra ist oder die Pyramiden, überall ist die Auseinandersetzung mit dem Himmel sichtbar. Und das ist keine sprachanalytische Frage – wie man in der Philosophie ja oft davon spricht: „It’s all language“, der linguistic turn –, sondern eine rein naturphilosophische Fragestellung.
Der Kosmos macht uns sprachlos. Und wir haben alle möglichen Deutungen vorgenommen: Die Götter waren da, die verschiedenen Mysterienhelden sind da oben unterwegs – unsere Sternbilder sind nichts Anderes als Geschichten, die wir an den Himmel schreiben. Und heute schreiben wir eine ganz andere Geschichte hinein, die viel trockener, viel nüchterner ist, die sehr viel davon erzählt, was wir glauben, was wir kennen und können, nämlich, dass die Naturgesetze, die wir von der Erde kennen, überall im Universum gültig sind.
Das ist nun gar nichts Schönes mehr, also da sind keine Götter da, da ist auch niemand mehr da, der uns noch irgendwie sagen könnte, was wir tun sollen, sondern wir sind völlig auf uns zurückgeworfen. Und insofern ist für viele heute der Himmel gar kein Thema mehr, weil kaum noch jemand an den Himmel schaut.
Wenn doch jemand mal an den Himmel schaut – das erlebe ich immer wieder –, dann tritt meistens Stille ein. Meist fragt dann einer: „Harald, Du bist doch Astronom, was ist das denn da oben?“
Und dann kommt es ganz darauf an, ob jemand wissen will, wie die Sterne funktionieren, oder was diese zu bedeuten haben. Für uns Menschen waren sie , wenn man es jetzt mal ganz banal nimmt, zunächst einmal ein Kalender. Da es früher noch keine Kalender gab, sind die regelmäßigen Abläufe am Himmel die einzigen Zeichen für die Urmenschen gewesen, einigermaßen zu wissen, welche Zeit im Jahr ist. Das sieht man auch an der Scheibe von Nebra ganz deutlich. Das ist nichts Anderes als ein Kalendarium, um zu wissen: wenn die Plejaden in einer bestimmten Höhe über dem Horizont stehen, dann heißt es: Säen! Denn das hat sich bis jetzt bewährt.
Aber es war eben noch keine Kenntnis über die Zusammenhänge im Kosmos da. Und wenn man sich überlegt, dass dann ein paar tausend Jahre vergangen sind, in denen wir ohne Teleskope, nur mit dem bloßen Auge, Dinge am Himmel beobachtet haben – dann ist die Auseinandersetzung mit diesem Größten aller Größten, über das hinaus nichts mehr gedacht werden kann, schon ein wichtiges Grundproblem für uns und wir werden es auch nicht los. Der Himmel bleibt immer da.
Wenn wir jetzt weiter an der Bestrahlung unseres Planeten arbeiten, dann sehen wir natürlich immer weniger. Meistens ist die direkte Beleuchtung um uns herum so groß, dass wir kaum noch etwas sehen von den Sternen oder sogar von den Sternbildern. Vielleicht gelingt es uns ein bisschen, die Lichtverschmutzung einzudämmen. Aber wenn nicht, dann wird uns ein wesentlicher Teil unserer Erfahrung fehlen.
SCHAU INS BLAU: Bleibt die Moral damit etwas rein Irdisches?
HARALD LESCH: (lacht) Ja natürlich, etwas Menschliches.
SCHAU INS BLAU: Denn in der Astrophysik beschäftigt man sich ja mit Dingen, die über der Erde stehen. Ist Ethik für die Astrophysik überflüssig? Oder wendet man sich vielleicht mit dem Blick in den Himmel auch schlicht von so menschlichen Problemen wie dem Guten und dem Bösen ab? Sie sagen ja auch an anderer Stelle, dass die Natur diese Kategorien nicht kennt. Hat die Ethik hier vielleicht auch einfach keinen Platz?
HARALD LESCH: Die Ethik als die Theorie der Moral sagt uns ja etwas über unsere Handlungsnormen, wie wir handeln sollen. Vor allem im Umgang mit andern: Wie soll ich mich gegenüber meinen Mitmenschen verhalten, gegenüber meinen Mitbewohnern, gegenüber meiner Mitwelt – wenn ich mal den Begriff Umwelt umwandle in Mitwelt. Das heißt, da geht es um meine direkte Handlungsoptionen, um herauszufinden, ob das, was ich tue, im besten Sinne des Wortes gut ist, ich kein Leid anrichte.
Bei der Astronomie geht es ja zunächst einmal nur um Beschreibung, das heißt, was wir machen ist Inventur. Die Möglichkeit zu handeln ist dabei eher gering. Folglich haben wir hier gar keine ethischen Fragestellungen.
Ganz anders natürlich bei Teilen der Physik, die unmittelbaren Einfluss auf das gehabt haben, was in den letzten hundert Jahren auf der Erde passiert ist. Wir haben ja nächstes Jahr ‚100 Jahre Erster Weltkrieg‘. Das ist ein Paradebeispiel dafür, wie zum ersten Mal Grundlagenforschung verwendet worden ist, um direkt in Waffentechnologie umgesetzt zu werden. Stichwort ‚Giftgas‘: Da haben Deutsche im Ersten Weltkrieg Giftgas entwickelt, deutsche Chemiker, die einen Nobelpreis bekommen haben. Otto Hahn hat die Kernspaltung 1938 sicher nicht entdecket, um daraus eine Bombe zu machen. Aber den Studenten, die zum ersten Mal den Artikel gelesen haben, den er geschrieben hat, war sofort klar: „It’s a bomb!“ Das heißt, da kommt natürlich die Moral des Wissenschaftlers zum Tragen. Aber bei uns stellen sich diese Fragen eigentlich überhaupt nicht.
Wir haben natürlich auch keine Instrumente, keine Gleichungssysteme und keine Messapparate für Ethik oder für Moral.
SCHAU INS BLAU: Kant scheint aber sehr wohl eine direkte Verbindung zwischen dem Blick in den Himmel und dem moralischen Gesetz zu sehen.
HARALD LESCH: Ja, für ihn musste das moralische Gesetz irgendwo herkommen. Kant als der Philosoph des Apriori: Woher kommen meine Vorstellungen von Moral? Woher kommt das, dass ich intuitiv weiß, was gut ist?
Für Kant ist völlig klar: Die Moral ist in ihm. Und ich habe einmal in einem Buch geschrieben: Wenn Kant gewusst hätte, dass der bestirnte Himmel über ihm die Voraussetzung dafür ist, dass es ihn und seine Moralvorstellungen überhaupt gibt, dann hätte er wahrscheinlich den bestirnten Himmel weggelassen. Denn was die Würde von uns Menschen am Ende ausmacht, ist nicht der bestirnte Himmel, sondern das moralische Gesetz in uns. Also, wir bestehen zu 92% aus Sternenstaub. Und dass wir überhaupt da sind, verdanken wir gewissen kosmischen Prozessen. Dass aber mit uns dann so etwas auftaucht wie die Überlegung ‚Was soll ich tun?‘, das ist etwas völlig Neues. Das Universum schweigt zur Moral.
SCHAU INS BLAU: Sie haben in einem früheren Interview gesagt: „Astronomie trifft nicht nur den Verstand, es trifft auch den Bauch und das Herz.“ Wie kann man das verstehen? Denn Sie haben ja auch gesagt, dass die Astronomie sich eigentlich nur mit der Beobachtung beschäftigt, mit dem Niederschreiben von Tatsachen, die man beobachtet hat. Was also meinen Sie mit diesem Satz?
HARALD LESCH: Die Astronomie wird von Menschen durchgeführt. Und wir kommen nicht als Astronomen auf die Welt, sondern wir haben Erfahrungen gemacht. Wir könnten jetzt hier im Institut einmal herumfragen, warum sich die einzelnen Mitarbeiter für die Astronomie entschieden haben. Und wahrscheinlich sagen alle, dass sie einfach hemmungslos begeistert sind von diesem Fach. Sie machen das nicht, weil sie irgendein wirtschaftliches Ziel erreichen wollen – das kann man mit Astronomie sowieso nicht. Sie sind erkenntnisgierig und wollen wissen, wie die Dinge im Kosmos funktionieren.
Und diesen Antrieb könnte man auch mit dem ersten Satz aus Aristoteles Metaphysik zusammenbringen: Weil es in uns liegt, dass wir staunen; wir wollen etwas wissen. Und das liegt aber so tief in uns, dass kann nicht nur im Verstand verankert sein.
Wenn ich an die Schwierigkeiten und Krisen denke, durch die jemand geht, der dieses Fach studiert, dann muss es mehr sein. Und ich habe einmal in einem anderen Zusammenhang gesagt: Im Grunde genommen sind wir Astronomen alle Gott-Sucher – auch wenn wir Atheisten sind. Wir suchen alle nach der Auflösung des Geheimnisses: Was ist das da draußen? Was will uns das Universum sagen? Wo gehören wir eigentlich hin? Und insofern weiß ich ganz genau (nicht nur von mir, sondern auch von vielen meiner Kollegen), dass wir natürlich emotional enorm daran hängen, weil wir ja bis an die Grenzen der erkennbaren Wirklichkeit herangehen, wo wir keine Informationen mehr bekommen. Daher lässt sich das bei unserer Tätigkeit nicht vermeiden, dass jemand tatsächlich sagt: Das ist ja unglaublich.
SCHAU INS BLAU: Man könnte ja zu dem Schluss gelangen, dass die Erkenntnisse der Astrophysik nur weiter die menschliche Nichtigkeit unterstreichen: Das Universum dehnt sich aus und wird immer größer und Erde und Mensch im Verhältnis dazu immer kleiner. Worin sehen Sie im Anbetracht dieser Nichtigkeit dann noch den Anspruch einer Moral begründet?
HARALD LESCH: Der Mensch ist ja ein ganz besonderer Punkt, denn der größte Teil des Universums ist nicht so wie die Erde. 99,9 % des Universums sind ganz anders. Auf unserem Planeten hat sich die Materie in einer Art strukturiert, die etwas ganz Besonderes darstellt. Das Leben ist ein Phänomen, das viel rätselhafter ist als viele andere Strukturmechanismen im Universum. Wenn es stimmt, dass das Universum expandiert, dann muss man sich fragen: Wieso gibt es überhaupt irgendeine Materie, die sich zusammengeklumpt hat? Denn wenn etwas auseinanderfliegt, dann neigt die Materie im Allgemeinen nicht dazu, dass es auf einmal zu irgendeiner Strukturbildung kommt.
Das ist aber vergleichsweise banal im Vergleich zu dem Phänomen, dass sich aus völlig unbelebter Materie Leben entwickelt hat. Und dass dieses Leben über Jahrmilliarden praktisch nichts Anderes gemacht hat, als nur eine Einzellerform zu bilden, bis hin dazu, dass es jetzt Lebewesen gibt, die sich sogar ihrer selbst bewusst sind und die damit auch anfangen, eine bestimmte Form von Wechselwirkung mit der Umgebung vorzunehmen, die es vorher nicht gab
Dadurch stellt sich die Frage: ‚Was soll ich tun?‘. Und weiter: ‚Soll ich etwas tun, was alles kaputt macht? Oder soll ich einfach etwas tun, sodass das Spiel weitergehen kann?‘ Und an der Stelle ist Philosophie die Strukturwissenschaft schlechthin, die einerseits versucht, Begriffe zu klären und zum anderen sogar in metaphysischen Entwürfen herauszudestillieren, was das Wirkliche ist, also das Sein des Seins.
Es gibt Individuen, die Ziele haben und die nicht ohne weiteres auf physikalische Gesetze zu reduzieren sind, daher reicht der reduktionistische, rein naturwissenschaftliche Ansatz nicht. Ganz zu schweigen von der inneren Perspektive einer jeden Person, die nicht messbar ist. Aber vor allen Dingen stellt sich heraus, dass nach dieser Metaphysik die gesamte Welt einen Motor hat, nämlich: Möglichkeiten auszuprobieren., die vorher gar nicht da waren. Das Leben ist ein Freiheitsraum für Materie. Und wir sind eine besonders aufmerksame, der Umwelt zugetane Form von Materie, die ihre Freiheit – hoffentlich – auch erlebt, also innerhalb der Grenzen, die eben durch die Naturgesetze gegeben sind. Und da ist die Moral, wie ich sagen würde, eine völlig normale Station.
Nur heute würde ich eine Moral haben wollen, die, gerade weil wir so viel über unseren Planeten wissen und was wir alles angerichtet haben im besten und schlechtesten Sinne des Wortes, dass unsere Moral heute ganz anders blicken muss als beispielsweise noch zu Kants Zeiten. Die Reichweite unserer (moralischen) Entscheidungen muss uns viel klarer werden.
Wenn wir heute irgendetwas machen, dann müssen wir uns auch immer als global Handelnde im Geiste sehen: Rosen aus Kenia oder Tansania können, was die CO2-Bilanz betrifft, viel günstiger sein als Rosen aus Holland; dort ist es viel aufwendiger, um die Rosen im Frühling züchten zu können, und die Transportkosten für die Rosen aus Afrika sind viel geringer – nicht nur Kosten, sondern auch die CO2-Emission. Das weiß kein Mensch, aber man kann so über die Sachen denken. Das heißt, die moralischen Fragestellungen werden uns nicht verlassen, sondern im Gegenteil, je mehr wir können, umso mehr suchen wir danach.
SCHAU INS BLAU: Sie meinten einmal, die Physik sei die Königsdisziplin unter den Wissenschaften. Das klingt nun aber eher danach, als ob die Philosophie die Königsdisziplin ist?
HARALD LESCH: Die Physik macht uns handlungsfähig, da ist sie sicherlich die absolute Nummer eins! Unsere Handlungsfähigkeiten sind ganz stark davon geprägt, dass wir unsere Welt so erforschen, wie wir sie erforschen. Nur darüber nachzudenken, was wir alles können, auf der einen Seite – und ob wir das, was wir können, auch sollen, das ist eine ganz andere Frage. Aber die Bereitstellung der Instrumente, überhaupt Optionen zu haben, das gehört zur Physik. Die Frage, was wir dann damit machen, das ist die Philosophie.
SCHAU INS BLAU: Sie sind ja von Science-Fiction nicht gänzlich abgeneigt. Daher haben wir uns gefragt: Denken Sie, dass es – mit Star-Trek-Vokabular gesprochen – für die „Eroberung des Kosmos“ eine Art Oberste Direktive braucht? Und wenn ja, wie sieht die aus?
HARALD LESCH: (lacht) Also, wenn man das wirklich machen will, dann muss zuhause erst einmal alles klar sein. Keine Zivilisation baut Raumschiffe, wenn zuhause auf dem Planeten noch irgendwelche Auseinandersetzungen stattfinden: Es darf nur entweder eine Religion geben oder keine. Es dürfen keine politischen Auseinandersetzungen stattfinden, bei denen es am Ende heißt: ‚Ja, aber jene, die wir da vor 20 Jahren losgeschickt haben, die sind aus dem anderen Lager und kriegen jetzt von uns überhaupt keine Informationen mehr‘.
Aber es wäre ohnehin so, dass die Reise ins Universum eigentlich für alle, die losreisen, eine Reise ohne Wiederkehr ist. Also wenn wir etwas tun, dann tun wir es, um andere Planeten zu „erobern“ und da zu siedeln. Die Vorstellung von irgendwelchen Science-Fiction-Geschichten, wir könnten wieder nach Hause fliegen, das geht nicht. Die Abstände zwischen den Sternen sind so groß, dass schon Reisen, die in unserer kosmischen Heimat hier, also nur in der Milchstraße, stattfinden sollen, mit annähernder Lichtgeschwindigkeit vollzogen werden müssen. Und dann hat man keine gemeinsame Zeit mehr, dann können wir uns nicht verabreden. Wenn ich einmal für ein paar Sekunden mit annähernder Lichtgeschwindigkeit fliege, dann sind hier auf der Erde ein paar tausend Jahre vergangen.
Es gibt keine Vorstellungen davon, was es bedeuten würde, wenn eine Zivilisation auf einem Planeten wirklich in der Lage wäre, zwischen den Sternen zu reisen. Das lässt sich nicht einmal auch nur ansatzweise formulieren, weil das außerhalb unserer gedanklichen Möglichkeiten ist.
SCHAU INS BLAU: Das heißt also, eine Oberste Direktive wäre das kleinste Problem dabei?
HARALD LESCH: Das würde ich auch sagen, genau. Man könnte sich natürlich vorstellen, dass – wenn man es geschafft hat, seine Zivilisation auf seinem eigenen Planeten so lange stabil zu halten – dann weiß man, was wichtig ist. Dann ist man durch sämtliche Flaschenhälse, durch die eine Gesellschaft durch muss, durchgegangen. Und tut nur noch das, was man für richtig hält. Vorher fängt niemand an, interstellare Raumschiffe zu bauen.
Metaphern & Wahrheitsanspruch
SCHAU INS BLAU: Um im Bereich der Fiktion zu bleiben: Sie wählen für ihre Darstellung häufig eine sehr bildhafte und metaphernreiche Sprache statt die blanke, vielleicht auch ‚kalte‘ mathematische Sprache. Warum?
HARALD LESCH: Weil ich will, dass Sie etwas verstehen von dem, was ich sage. Ich benutze meine Muttersprache und spiele mit ihr, soweit ich nur irgendwie kann. Erst einmal, weil es mir Vergnügen macht, sie zu verbiegen und zu verbauen. Ich erzeuge gerne Assoziationen und Bilder, die interessant sein könnten und mit denen meine Zuhörer etwas anfangen können, bis hin zu einem Lächeln oder einem Lacher. Denn ich weiß von meinen Neuro-Kollegen, dass ein Lachen im Gehirn mehr Verankerung bringt als die überzeugendsten Argumente.
SCHAU INS BLAU: Wird vielleicht auch eine bildhafte Sprache dem Gegenstand eher gerechter? Schließlich bewegen wir uns mit der Astrophysik in einem Wissenschafts- und Gegenstandsbereich, den der normale Verstand nur schwer begreifen kann und wo eventuell auch das menschliche Vorstellungsvermögen an seine Grenzen stößt.
HARALD LESCH: Große Teile der Astronomie sind automatisch sehr anschaulich, weil es sich um große Objekte handelt. Das ist ja nicht so wie in der Elementarteilchenphysik, in der man nichts sehen kann. Die Sonne sieht man; und die ganzen Bilder von den umkreisenden Planeten, das kann man sich vorstellen. Nichtsdestotrotz haben Sie natürlich Recht: Die wirklichen Dimensionen sind so unvorstellbar, dass einem gar nichts Anderes übrig bleibt als ein Bild zu benutzen: Wenn man die Milchstraße auf die Fläche Europas bringen würde, dann wäre die Erde eben nur ein Staubkörnchen. Das heißt, natürlich ist der abstrakten Dimension ganz stark geschuldet, dass man mit Metaphern arbeitet.
Aber ich wüsste auch gar nicht, welche Möglichkeiten ich hätte, das sonst zu machen. Ich will ja keinen mathematischen Vorkurs halten.
SCHAU INS BLAU: Aber glauben Sie, dass man durch die Verwendung von Metaphern wie beispielsweise ‚schwarzes Loch‘ nicht um die eigentliche objektive Wahrheit nur herumkreist, ohne sie wirklich zu erfassen?
HARALD LESCH: Ja klar, sicher. Wir haben durch die Verwendung von Metaphern erst einmal einen großen Informationsverlust. Und trotzdem würde ich sagen, das ist der einzige gerechtfertigte Weg, weil bei allem Informationsverlust doch immer noch klar wird, worum es geht. Zum Beispiel, indem man die Dinge in Relationen zueinander stellt: Naja gut, die Sonne hat heute einen Radius von 700.000 km – das kann man sich nicht vorstellen –, aber wenn diese Masse von 333.000 Erdmassen – das kann man sich auch nicht vorstellen – auf 3 km zusammengequetscht wäre, dann würde noch nicht einmal mehr Licht wegkommen. Man kann das immer vergleichen mit dem, was nötig ist, um von der Erde weg zu kommen, diese Entweichgeschwindigkeit, und wie die anstiege, wenn die Erde auf 9 mm zusammenschrumpfen würde – die ganze Erde auf 9 mm! Dann wäre die Erde ein schwarzes Loch, dann wäre sie ein Objekt, von dem nicht einmal mehr Licht entweichen könnte.
SCHAU INS BLAU: Denken Sie, dass eine objektive Wahrheit für uns überhaupt (be)greifbar ist, oder ist durch unsere Perspektive (von der Erde aus, als Mensch, …) die Wahrheit immer bereits subjektiv gefärbt? Oder anders gesagt: Ist der Zugang des Individuums zum Kosmos durch sein Ich immer bereits beschränkt?
HARALD LESCH: Das versuchen wir zu objektivieren, indem wir in den Naturwissenschaften eine möglichst intersubjektive Sprache benutzen: die Mathematik. Das heißt, wir versuchen, kulturelle Hintergründe und die sonstigen Hintergründe aller beteiligten Subjekte so weit herauszulassen, dass am Ende tatsächlich nur noch etwas Glasklares und Eisenhartes, Geschichtsloses, Zeitloses, überall auf der Welt und im Universum Reproduzierbares dabei herauskommt.
Und auf diese Ergebnisse sind wir besonders stolz, weil das für uns bedeutet: Das sind die ewigen Prinzipen, nach denen sich das ganze Zeitliche vollzieht.
Dass die interessantesten Fragen immer diejenigen sind ‚Wie hat denn das angefangen und wie ist es dann weiter gegangen?‘, das bringt uns in den empirischen Wissenschaften schon ziemlich in die Bredouille. Denn wir hätten ja gerne immer zeitlose, also völlig geschichtslose, immer reproduzierbare Ergebnisse, die völlig unabhängig vom Subjekt sind. Aber schon unser eigenes Leben ist nicht mehr zufällig; das Leben auf der Erde ist kein Zufall, sondern da hat sich etwas getan, es muss bestimmte Abläufe gegeben haben. Wenn wir in der Zeit zurückgehen und das Ganze wieder von vorne loslaufen lassen würden, würde etwas ganz Anderes passieren.
Das heißt, wir haben ganz verschiedene Fragestellungen, die zu unterschiedlichen Formen von „Wahrheit“ führen. Wir sind als kritische Rationalisten in den Naturwissenschaften gehalten, nicht von Wahrheit, , sondern nur von Wahrheitsähnlichkeit zu sprechen. Wir können nicht sagen, dass wir die Wahrheit gefunden haben; aber wir kommen ihr so nahe, wie es nur irgendwie geht.
Niemand kommt der Wahrheit näher als diejenigen, die nur nach ihr suchen und nicht bereit sind zu sagen: So, jetzt haben wir sie gefunden.
Und insofern ist der Prozesscharakter der empirischen Wissenschaft die Suche nach Wahrheit – und zwar unabhängig von den Subjekten, die sie betreiben. Das heißt, wir sind nicht besonders personenzentriert; wir haben keine Schulen, die nach irgendjemandem benannt sind; bei uns spielt es überhaupt keine Rolle, bei wem man studiert hat. Es geht nur darum, was man kann, nicht, woher man kommt. Das heißt, die ganzen subjektiven Eigenschaften werden außen vor gelassen.
SCHAU INS BLAU: Das heißt, bei Ihnen stellt sich die Frage nach dem Verhältnis von Individuum und Kosmos gar nicht, so wie wir es hier aufzuspüren versuchen? Sondern Sie versuchen, das Individuum bei allem einfach herauszulassen?
HARALD LESCH: Bei der Forschung schon. Wenn man aber fragt: ‚Was bedeutet das für dich, für dich als Forscher?‘, dann ist das Subjekt natürlich sofort wieder da. Denn es wird angesprochen durch das ‚Du‘ und dann muss es Farbe bekennen.
SCHAU INS BLAU: Was bedeutet Ihnen persönlich der Blick in den Himmel: Steht für Sie der Erkenntnisgewinn im Vordergrund? Oder eine Vermittlung dieser Erkenntnisse? Oder gar die Ästhetik einer Himmelsbetrachtung?
HARALD LESCH (nach langem Schweigen): Also wenn Ästhetik etwas damit zu tun hat, dass ich mich wohl fühle in der Welt, dann hat es etwas mit der Ästhetik zu tun. Aber ich fühle mich dann besonders wohl, wenn ich viel von dem verstehe, was um mich herum vor sich geht. Das heißt, für mich hat Erkenntnis immer etwas mit Ästhetik zu tun. Ich finde es einfach sehr ästhetisch, viel zu wissen. Das ist für mich ein sehr wichtiger Baustein meiner Persönlichkeit.
Jetzt einmal wirklich ganz konkret: Wenn ich abends in den Himmel schaue, denke ich nicht astronomisch oder astrophysikalisch, sondern ich freue mich. Sonst nichts. Und diese Freude – vielleicht im Hintergrund die Freude, die gespeist wird dadurch, dass ich, wenn ich wollte, es mir erklären könnte, was ich da sehe, aber ich will es gar nicht – die liefert mir ein Gefühl des großen Aufgehoben-Seins. Und dieses Gefühl, das Wohlfühlen, das hat für mich ganz viel mit Ästhetik zu tun. Ich umgebe mich mit lauter Dingen – auch wenn es hier in meinem Büro sehr chaotisch aussieht – die mir wohl tun.
SCHAU INS BLAU: Zum Abschluss eine ebenfalls persönliche Frage, zu der wir eventuell ein Stück weit in den Bereich der Science-Fiction zurückkehren: Wenn Sie sich jetzt sofort, ungeachtet der tatsächlichen momentanen Möglichkeiten, eine Frage bzgl. des Kosmos beantworten könnten, welche wäre dies: Die räumliche Ausdehnung des Universums zu erfahren? Den Beginn des Kosmos bzw. das Ende zu erfahren oder zu erleben? Endlich eine Antwort auf die Frage: Sind wir allein? Oder vielleicht etwas ganz Anderes?
HARALD LESCH: Genau: ‚Sind wir allein im Universum?‘ – das würde ich gerne wissen! Also da bin ich wieder ganz persönlich: Ich möchte gerne wissen, ob es noch andere Lebewesen gibt, mit denen es sich lohnen würde, vielleicht das ein oder andere Gespräch zu führen und zu fragen: Welche Märchen erzählt ihr euren Kindern? Welche Bilder mal ihr? Welche Musik macht ihr? Und an welche Götter glaubt ihr? Mich interessiert nicht, wie das Universum angefangen hat. Und wie es aufhören wird, will ich auch nicht wissen. Sondern ich will jetzt wissen, ob es hier noch andere gibt, die mir vielleicht etwas erzählen können über das Universum, was wir noch nicht wissen.
SCHAU INS BLAU: Das heißt, da siegt dann wieder der Mensch über den Astrophysiker in Ihnen?
HARALD LESCH: Ja, selbstverständlich. Unbedingt! Bleiben Sie Mensch – auch wenn Sie Astronom sind!
SCHAU INS BLAU: Herr Lesch, wir danken Ihnen ganz herzlich für das Gespräch!

Harald Lesch, geboren 1960, ist Professor für Theoretische Astrophysik an der LMU und lehrt Naturphilosophie an der Hochschule für Philosophie in München. Bekannt ist Lesch durch seine Moderationstätigkeit in den Fernsehsendungen alpha-Centauri, Lesch & Co., Denker des Abendlandes, Alpha bis Omega und Abenteuer Forschung. Für seine Arbeit und sein Engagement in der Wissensvermittlung wurden ihm zahlreiche Preise verliehen, etwa der Preis für Wissenschaftspublizistik der Grüter-Stiftung im Jahr 2004.