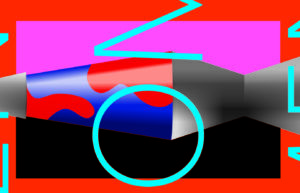Phur-Ri, der fliegende Berg, so nennen die Nomadenstämme von Kham einen 6000er im Transhimalaya, an dessen Fuß sie ihre Zelte aufschlagen und die Yaks weiden lassen. Ein Berg der einmal ein Stern war, und irgendwann auch wieder in den Himmel zurückfliegen wird. Für zwei Brüder aus Irland ist dieser Berg zunächst etwas völlig anderes: ein weißer Fleck auf der Landkarte, noch nie vorher bestiegen, nirgendwo verzeichnet, nur ein Foto hat Liam, der Geologe und Computerfreak, in den Weiten des Internet entdeckt, ein Foto, das neben einem bekannten Berg noch einen weiteren, höher aufragenden, unbekannten Gipfel zeigt. Diesen Gipfel will er entdecken, erobern, so wie er und sein Bruder in ihrer Kindheit die irischen Hügel eroberten, als Rekruten ihres fanatisch katholischen, kriegspielenden Vaters “Captain Daddy”.
Die im Folgenden präsentierte Rezension entstand im Rahmen der von Dr. Evi Zemanek an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg angebotenen Übung “Rezensionen schreiben”. Zum Zweck einer kontrastiven Beleuchtung der besprochenen Neuerscheinungen ebenso wie zur Demonstration verschiedener kritischer Betrachtungsweisen sind je zwei von StudentInnen verfasste Rezensionen einander gegenübergestellt.
Eine archaische Geschichte von ungeheurer Sprach- und Naturgewalt
Phur-Ri, der fliegende Berg, so nennen die Nomadenstämme von Kham einen 6000er im Transhimalaya, an dessen Fuß sie ihre Zelte aufschlagen und die Yaks weiden lassen. Ein Berg der einmal ein Stern war, und irgendwann auch wieder in den Himmel zurückfliegen wird. Für zwei Brüder aus Irland ist dieser Berg zunächst etwas völlig anderes: ein weißer Fleck auf der Landkarte, noch nie vorher bestiegen, nirgendwo verzeichnet, nur ein Foto hat Liam, der Geologe und Computerfreak, in den Weiten des Internet entdeckt, ein Foto, das neben einem bekannten Berg noch einen weiteren, höher aufragenden, unbekannten Gipfel zeigt. Diesen Gipfel will er entdecken, erobern, so wie er und sein Bruder in ihrer Kindheit die irischen Hügel eroberten, als Rekruten ihres fanatisch katholischen, kriegspielenden Vaters “Captain Daddy”.
So machen sich die Brüder auf, von Horse Island, einer stürmischen Insel, wohin sich Liam und sein Bruder zurückgezogen hatten, in die Gebirge Osttibets. Vom brausenden Meer, das sie bei ihren Klettertouren am felsigen Steilufer von Horse Island manchmal fast verschlungen hätte, in Höhen, in denen jeder Wetterumschwung den Tod bedeuten kann. Zwei Meermenschen in den höchsten Bergen der Welt.
In dieser extremen, unberechenbaren Naturgewalt, die Meer und Gebirge gemeinsam ist, auf ihrem Weg in der Vertikalen, suchen sie nach etwas — nach der Wahrheit und der Liebe. Der Erzähler scheint sie zu finden. Er verliebt sich in ein Mädchen des Nomadenstammes, in dessen Begleitung sie dem Phur-Ri entgegen ziehen. Nyema. In seiner poetischen Liebe zu Nyema scheint die Wahrheit zu liegen, die sein Vater im Kampf gegen das protestantische England vergeblich beschwört hatte, solange bis ihn seine Frau Shona verließ und mit einem Protestanten flüchtete, und die auch Liam erfolglos suchte in seiner Gier, das Unbekannte zu erobern und über Gebirge zu herrschen, wie er es in seinen Simulationen vor dem Bildschirm vermochte.
Doch das Verhältnis der Brüder scheint unter dieser Liebe zu leiden, oder vielmehr bemerkt der Erzähler erst in seiner Nähe zu seinem geliebten Mädchen, wie er Nyema nennt, die Entfremdung von seinem Bruder. Das einzige, worüber die beiden noch gemeinsam lachen können, ist ihre Kindheit. Liam, der Ältere, hatte seinen jüngeren Bruder stets in den Schatten gestellt, und auch jetzt fühlt sich der Erzähler noch wie ein lästiges Anhängsel, als habe Liam ihn nur mangels eines besseren Begleiters gebeten mitzukommen. Für die Liebe seines Bruders hat Liam, der in seiner Heimat stets seine Homosexualität verbergen musste, kein Verständnis, er nimmt sie nicht ernst, akzeptiert nicht, dass sein Bruder gefunden hat, was er suchte, und gar nicht mehr danach giert den Phur-Ri zu besteigen.
Dies ändert sich erst, als in einer Nacht der Gipfel dieses Bergs aus einem Wolkenfenster bricht, während der Erzähler allein vor dem Zelt kauert. In diesem Moment erscheint ihm genau das, was er zuhause in Irland auf dem von Liam im Internet gefundenen Foto gesehen hatte. Es überwältigt ihn. Trotz der Warnungen der Nomaden brechen die Brüder nun gemeinsam auf, dem Gipfel des fliegenden Berges entgegen. Auf diesem letzten Weg kommen sich die Brüder näher, empfinden in der brutalen Härte der Natur füreinander das, was ihnen schon so lange abhanden gekommen war: Bruderliebe… Doch nur einer der beiden kehrt vom Gipfel zurück.
In Ransmayrs Geschichte vom fliegenden Berg, scheint auch die Sprache zu fliegen. Flattersatz, nennt er das, was durch die variierende Zeilenlänge zunächst so aussieht, als handele es sich um einen lyrischen Text. Und tatsächlich ist es fast wie ein Gesang, ein erzählender Sprachgesang, den er auf seinen Reisen durch Tibet den Nomaden abgelauscht habe, wie er sagt. Als ganz natürlich sehe er diese Art des Satzes an, er selber und wir alle strukturierten schließlich auch unbewusst unsere handschriftlichen Notizen auf diese Weise. Der Leser habe sich nur so sehr an die vollen Seiten gewöhnt, dass er erst wieder zurückfinden müsse in die “ursprüngliche” Sprache, in der einzelne Wörter, bestimmte Teile von Sätzen und vor allem Namen, in denen die Essenz der Sprache begründet liegt, noch genug Platz haben ihre eigene Bedeutung zu entfalten.
Zurückfinden ist überhaupt das Stichwort. Ransmayrs Roman ist ein Roman vom Zurückfinden — “waren nicht alle unsere Wege von Anfang an Rückwege gewesen?” -, denn er ist von Extremen geprägt, von Computertechnologie und archaischem Nomadenleben, von Liebe und Tod, von tiefsten Tiefen und höchsten Höhen und er reißt den Leser, der einfach nur zuhören muss, mit auf seinem Rückweg in der Senkrechten.