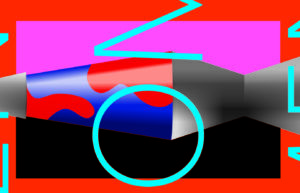© privat
von Veronika Raila
Man nehme 500 g Mehl, gibt dies durch ein feines Sieb in eine große Schüssel. In einer zweiten, etwas kleineren, zerbröselt man den Inhalt eines Päckchens Hefe, gibt darauf etwas lauwarme Milch, zerdrückt dann die Brösel ein wenig, streut einen Esslöffel Zucker und eine Prise Salz darüber. Man reibt die Schale einer Zitrone darüber. Schließlich nimmt man ein bisschen von dem gesiebten Mehl, streut es darauf und vermengt das Ganze so lange, bis ein sehr dickflüssiger, eher etwas lehmiger Teigkloß entsteht. Mit den Händen wird das Mehl in der großen Schüssel so geformt, dass sich eine Grube bildet. Vorsichtig legt man dann in diese den Teigkloß hinein, bestäubt ihn mit ein bisschen Mehl aus dem Sieb, bis er ganz zugedeckt ist. Zum Ruhen schlägt man die Schüssel mit einem Leintuch ein und stellt sie an einen warmen Ort, damit er gedeihen kann.
Wie oft hatte sie diese Zeilen gelesen? Auswendig kannte sie die Wörter, manche Buchstaben waren bereits so abgegriffen, dass sie nicht einmal mehr ihre Schatten hinterlassen haben. Etwas müde setzte sie sich auf den Stuhl. Die Schüssel mit den Zutaten stellte sie an einen warmen Ort neben der Heizung und begann, die etwas alten und zum Teil schon verschrumpelten Äpfel zu schälen.
Mit der rechten Hand griff sie das kleine Messer, das vom vielen Schleifen nur noch eine schmale Klinge aufwies, in die linke Hand nahm sie einen von den alten und schon etwas verhutzelten Äpfeln. Zügig halbierte und viertelte sie ihn. Nun nahm sie ein Viertel, setzte das Messer am Stiel an, folgte dem Halbrund des Kernhauses, kippte es heraus und löste mit einem gekonnten Ruck den Strunk vom Fruchtfleisch. Jetzt setzte sie das Messer erneut am fehlenden Stiel an, führte die Klinge genau zwischen Fruchtfleisch und Schale hindurch. So löste sie in drei bis vier Streifen die Haut vom fruchtigen Fleische ab. Jedes dieser Stücke wurde noch einmal längs durchgeschnitten. Der Baum, von dem die Äpfel stammen, pflanzte Opa schon vor langer Zeit, wenn sie genau überlegte, um die Zeit ihrer Heirat.
Die Apfelstücke lagen, befreit von Kernhaus und Schale, leicht bräunlich vor ihr auf dem Brett aus Holz. Mit ihren immer noch sehr schlanken, aber zum Teil schon steifen Fingern, sammelte sie die Achtel flink ein, um Platz für den Teig freizumachen. Sie nahm keinen Kochlöffel oder gar so ein modernes Rührgerät, nein, sie griff mit den Händen in den lehmigen Kloß, quetschte ihn, bis die feuchte Masse zwischen den Fingern heraus quoll. Sie nahm von der Seite etwas Mehl dazu und wiederholte diesen Vorgang. Es formte sich ein größerer, trockenerer Teig, den man jetzt rollen konnte. Das restliche Mehl arbeitete sie wieder mit den Händen ein, rollte ihn ein letztes Mal rund. Zärtlich tätschelte sie ihr Werk, legte es in die große Schüssel zurück. Wiederum bestäubte sie den Teigkloß mit etwas Mehl, bedeckte ihn schließlich mit einem Tuch und stellte die Schüssel an einen warmen Ort, damit er gehen konnte.
Sie wischte den Tisch ab, legte das große Nudelbrett darauf, staubte dieses mit Mehl ein, mischte in einem Glas Zimt mit Zucker und legte das Nudelholz zurecht. Sie dachte an früher, als sie von ihrer Mutter das Backen gelernt hatte, dachte auch daran, dass man damals zum Nudelholz noch Warglholz sagte, naja, man kann die modernen Zeiten nicht aufhalten. Jetzt hatte sie ein bisschen Zeit und weil sie schon etwas müde geworden war, setzte sie sich auf den Küchenstuhl.
Ihre Blicke streiften liebevoll über die Einrichtung. Nein, mit den modernen Hochglanzküchen konnte diese nicht mithalten. Die Oberfläche der Kästen ist, wie es damals modern gewesen war, in sich gemustert, ganz leicht, nicht aufdringlich, aber doch licht und hell. Der Herd hatte schon mehrere Reparaturen hinter sich, der Kühlschrank, der neben dem Spüleschrank eingebaut war, lief die ganze Zeit, ein Zeichen, dass der Motor schwach und müde war und bald aufgeben würde. Eigentlich hatte sie gehofft, dass sie in diesem Leben keinen Neuen mehr kaufen müsste.
So, jetzt aber nicht weiter sinnieren, der Teig war gegangen. So zärtlich, wie sie ihn hineingelegt hatte, nahm sie ihn jetzt aus der Tiefe der Schüssel heraus, legte ihn auf das Brett und teilte den Kloß in vier, möglichst gleich große Teile. Mit dem Handballen drückte sie ein Viertel flach. Das Warglholz legte sie in der Mitte auf den entstandenen Teigfladen, nahm mit der linken und rechten Hand die hölzernen Griffe, gab Druck auf das Holz und versuchte das Viertel in jede Richtung auszurollen. Aber so sehr sie sich anstrengte, der Teig war widerspenstig und zäh, es wollte ihr nicht gelingen. Er fügte sich nicht in die gewünschte Form.
Sie legte das Holz zur Seite und begann, ihn mit den Händen auszuziehen. Fest umgriff sie den etwas dickeren Rand und zog so, wie man ein Leintuch zieht, nachdem es eingesprengt wurde, um dieses möglichst glatt zu bekommen. Der Teig widersetzte sich immer noch. Nun griff sie vehementer und mit gespreizten Fingern in die Masse des Teiges hinein.
Das Feuchte und Klebrige formt sich auf einmal zu Bändern und beginnt mit ihr zu spielen. Es umwickelt die Finger, einzeln, von der Kuppe bis zum ersten Glied, hält ein bisschen inne, der Teig orientiert sich, umwickelt das mittlere Glied, hält da wieder inne und entschließt sich letztendlich ganz bis zur Wurzel der Finger hoch zuwandern. Die Frau erschrickt. Nun sammeln sich die einzelnen Teigbänder zu einem größeren, der sich des Ballens, der Innenfläche und schließlich des Handrückens bemächtigt. Nach einer kurzen Rast schlängelt sich der Teig gegen den Uhrzeigersinn beide Arme hoch und hält erst inne, als der Oberarm fast ganz bedeckt ist. Jetzt wundert sie sich doch über sich selbst, sie empfindet diese Einkleidung nicht als gänzlich unangenehm. Der Teig ist feucht und warm, er klebt auf der Haut, aber er schenkt auch ein Gefühl der Geborgenheit.
Sie setzte sich wieder auf den Stuhl und ruhte ein bisschen aus. Nein, jetzt hätte sie beinahe die Wäsche vergessen, sie springt auf, geht in die Waschküche hinunter und holt die Kochwäsche aus der Maschine. Seltsam, beim Anfassen der Wäsche bleibt kein auch noch so kleines Stückchen Teig an derselbigen haften. Alles schnell auf die Leine gehängt und wieder in die Küche zurück.
Zwei Viertel des Teiges lachen sie vom Nudelbrett aus an, angriffslustig nimmt sie eines davon und exerziert das gleiche Ritual. Keine Änderung der Form, einfach widerspenstig. Dann schiebe ich eben eine andere Arbeit ein. Sie will ins Bügelzimmer, um die Wäsche für den nächsten Tag einzusprengen, aber als sie die Klinke drückt, springt das Schloss nicht auf, sie versucht es nochmal und nochmal. Kein Eintreten möglich! Aber sie muss doch nachsehen, ob etwas nicht in Ordnung ist, also holt sie den Handbohrer und setzt ihn auf Augenhöhe an. Mühsam bewegt sich der Bohrer in das Holz, schließlich ist er dann doch mit einem Ruck durch. Sie zieht ihn heraus, wischt mit der teigüberzogenen Hand die Spreißel weg und schaut durch das Loch. Das Zimmer erscheint unverändert, alles liegt noch an seinem Platz, soweit sie sehen kann. Halt, bis auf, ja komisch denkt sie bei sich, bis auf das Taufkleid der Enkelin, sie hat angenommen, es wäre längst eingemottet, aber nein, da liegt es auf der Seite — ein leichter Hauch von einem Nichts das Überkleid, darunter schwere cremefarbene Seide. Ja, die Taufe ist schon etwas Besonderes gewesen. Alle hatten Angst, ob das Mädchen, aufgrund ihres zerbrechlichen Zustandes, die erste Zeit überleben würde. Aber sie tat es. Zurück in der Küche setzt sie sich wieder auf den Stuhl, argwöhnisch beobachtet sie den Teig. Vielleicht hört der Teig auf dieses Kinderlied? Sie spricht mehr, als sie singt:
Backe, backe Kuchen,
der Bäcker hat gerufen.
Was ist das? Der Teig bewegt sich, eine Welle formt sich und rollt vom spitzen bis zum stumpfen Ende und wieder zurück. Dann ändert sie die Richtung und kommt von der Seite her. Ein gewaltiges Durcheinander ergibt es, als sich dann noch eine Blase aus der Mitte des Teiges erhebt.
Wer will guten Kuchen backen,
der muss haben sieben Sachen,
Aus dieser Blase, die zu pulsieren beginnt, formt sich mit der Zeit ein Ohr, es sieht aus wie ein richtiges menschliches Ohr, mit äußerem Wulst, muschelartiger Vertiefung und einem Läppchen. Der Wulst kippt einmal hoch, das nächste Mal hinunter. Die Muschel wölbt sich nach außen und dann nach innen, im Läppchen sieht man das Herz schlagen, immer und immer wieder. Dieser Tanz wiederholt sich einige Male, er verlangsamt seinen Rhythmus und kommt schließlich zum Stillstand. Ruhig liegt das Ohr nun vor ihr.
Eier und Schmalz,
Zucker und Salz
Das Läppchen beugt sich nach oben, der Teig unter dem Ohr windet sich zu einem Strang, der schließlich das Ohr nach oben hebt. Immer länger wird der Strang, der wie eine Schlange vor ihrem Beschwörer zu tänzeln beginnt.
Backe, backe Kuchen,
der Bäcker hat gerufen.
Das Ohr mit seinem Fuß scheint darauf zu hören.
Wer will guten Kuchen backen,
der muss haben sieben Sachen,
Es tänzelt von links nach rechts und wieder zurück. Macht eine kleine Verbeugung, geht in die nicht sichtbaren Knie, dreht eine Pirouette, wendet auf dem Fuß und geht rückwärts in die Ecke des Nudelbrettes. Das letzte Viertel arbeitet sich in die Mitte der Bühne, robbt im Kreis, macht auf sich aufmerksam, bittet um das Lied.
Backe, backe Kuchen,
der Bäcker hat gerufen.
Das Viertel bleibt ruhig liegen, ein Band trennt sich vom Teigstück ab, folgt der Kontur des Viertelkreises, zuerst die beiden Seiten, dann über den Kreisbogen, um wieder ein Teil der beiden geraden Seiten abzutrennen und so weiter, und so weiter. Schließlich liegt ein Band aus Teig vor ihr, ein Band dessen dickeres Ende, einem Köpfchen gleich, selbiges in die Luft reckte und um Beschwörung bittet.
Wer will guten Kuchen backen,
der muss haben sieben Sachen,
Das Köpfchen beginnt sich nach hinten wegzubiegen und einzurollen, geradeso, wie man Wolle auf ein Strickknäuel wickelt. Das Knäuel wird immer dicker und rollt so lange, bis fast das ganze Band aufgewickelt ist. Dieser Rest zieht sich auseinander und wird hauchdünn, stülpt sich über die mittlerweile sehr fest gewordene Kugel. Die Teigschicht reißt quer in der Mitte durch, an den Kanten wachsen Wimpern, sehr dichte, dunkle Wimpern. Das Auge öffnet sich, blickt Oma an, sanft und gütig, dann schließt es sich wieder.
Eier und Schmalz,
Zucker und Salz,
Milch und Mehl,
Safran macht den Kuchen gehl!
Das Auge will tanzen. Es dreht sich auf der Stelle, bis ihm ein langer Fuß, geradezu wie dem Ohr, wächst. Es versucht die Kunststücke des Ohres nachzumachen, tänzelt von rechts nach links, macht eine kleine Verbeugung, geht in die nicht sichtbaren Knie, dreht eine Pirouette, und dreht und dreht bis, ja, bis es dem Auge schwindelig wird und es leicht grünlich, gelblich anläuft. Nun stellt es sich brav neben das Ohr in die Ecke des Nudelbrettes.
Oma lässt sich auf den Stuhl fallen, was die beiden Tänzer zum Anlass nehmen, sich wieder in die Mitte der Bühne zu bewegen. Beide machen eine kleine Verbeugung, halten den Atem an und warten auf den Einsatz des Kapellmeisters.
Backe, backe Kuchen,
der Bäcker hat gerufen.
Wer will guten Kuchen backen,
der muss haben sieben Sachen,
Eier und Schmalz,
Zucker und Salz,
Milch und Mehl,
Safran macht den Kuchen gehl!
Die beiden drehen sich zueinander, verbeugen sich, legen die Hände in der Figur des Walzers ineinander und beginnen sich im Takt zu drehen. Sie wiegen ihre Körper grazil, lebendig und fast ein bisschen geheimnisvoll. Das Tempo steigert sich. Die Musik ist in ihrem Kopf gut zu hören, das Auge links, das Ohr rechts, wiegen wieder zurück. Die Drehungen werden schneller und schneller, bis für die Oma nicht mehr erkennbar ist, wer gerade links und rechts tanzt. Die beiden Füße der Tänzer sind überfordert. Sie lösen sich nicht mehr schnell genug vom Brett, bleiben kleben, während die Oberkörper die Drehungen ausführen. Die Füße werden zu einer Spirale, fest ineinander verschlungen, die abschnellt.
So etwas ist nicht leicht zu verstehen, dachte Oma bei sich und beschloss, auf dem Flur auf und ab zu gehen. Klarheit wollte sie erlangen, alles im richtigen Licht sehen. Die Tür zum Wohnzimmer war nur angelehnt, sie stieß sie weiter auf. Alles war wie gewohnt, beim Alten, nichts hatte sich verändert. Gut so. Dann drückte sie die Klinke der Badezimmertür. Auch diese sprang gleich auf und gab den Blick frei – alles unverändert, doch das kleine Fenster war weit offen, der Wind blies kräftig herein. Sie schloss es und ging zum Schlafzimmer, vorbei an einem Türrahmen, den sie noch nie gesehen hatte.
Auch die Tür selbst ist ihr gänzlich unbekannt. Sie ist mit lauter kleinen Täfelchen aus Kupfer beschlagen, in die seltsame Zeichen eingraviert sind. Zeichen, die an Buchstaben erinnern, aber für sie nicht zu lesen sind. Der Rahmen ist aus Stein, Sandstein, um genauer zu sein. Neugierig nähert sie sich der Tür, der Teig auf ihrer Haut beginnt sich fester um die Arme zu ziehen, sie spürt den Druck, fröstelt dabei, Schweißperlen treten aus der Stirn, fließen zur Seite hin ab. All ihren Mut fasst sie zusammen, sie will sehen, was sich hinter dieser Tür verbirgt, lässt dann auf einmal die Hand kraftlos sinken.
Wieder zurück in der Küche, setzt sie sich nochmals auf den Stuhl, und begann zu sinnieren. Sie nestelte an ihrer Küchenschürze und holte ein Taschentuch hervor. Ihr Blick ging ins Leere.
Am nächsten Morgen fand man sie, ihr Kopf lag in dem ausgerollten und bereits sehr langen gegangenen Hefeteig. Als man sie liebevoll aufrichten wollte, blieb der bereits getrocknete Teig an ihrem Gesicht kleben. Vorsichtig wurde die Totenmaske entfernt, gebacken und gegessen. Auge und Ohr wurden für die Enkelin aufgehoben.
Schieb, schieb in’n Ofen ‘rein.

Veronika Raila, 1992 in Augsburg geboren musste schon immer alles aufschreiben, was sie zu sagen hatte. Nach einer verkürzten Gymnasialzeit fing sie an der Uni Augsburg an, Neuere deutsche Literaturwissenschaften und katholische Theologie zu studieren. Bald gab es auch erste Veröffentlichungen und Preise für ihr Schreiben (Medienecho & Preise). Nach der Bachelorarbeit widmete sie sich voll und ganz ihrem autobiographischen Film „Das Sandmädchen“, der Preise in der Kurzversion und einige in der Langversion (Sandmädchen – Ein Dokumentarfilm von Mark Michel und Veronika Raila) erhielt. Danach kehrte sie an die Uni zurück, um ihre Studien fortzusetzen. Literarisch sind ihre Arbeiten meist im phantastischen Realismus anzusiedeln. Kafka hat sie immer unglaublich inspiriert, daneben Botho Strauß und die Lektüre der mittelalterlichen Heldengeschichten. Sollte sie einmal nicht schreiben oder lesen, frönt sie dem Malen, dem Malen ihrer inneren Bilder.