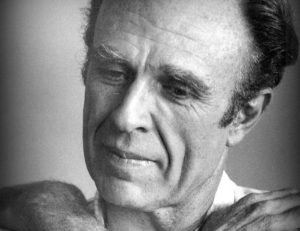von Tabea Krauß
Bücher, die von Büchern handeln, haben einen ganz eigenen Zauber. Bücher, in denen Lesen zum Abenteuer wird, ziehen uns besonders in ihren Bann. In Nino Haratischwilis Roman „Juja” wird Lesen zum tödlichen Abenteuer.
Die Story ist großartig unheimlich. Ein dünnes Heftchen treibt gleich Goethes Werther Lesende zur Selbsttötung. Genau genommen Leserinnen. Das Heft enthält die Gedanken einer 17-Jährigen, die in den 50er Jahren in Paris in einer Dachkammer haust und ihre apokalyptischen Phantasien poetisch aufbereitet niederschreibt, bevor sie sich vor den Zug wirft. Veröffentlicht werden Jeanne Sarés nachtschwarze Notizen erst mehr als 20 Jahre später in einem kleinen Verlag.
Das Buch wirkt wie eine Droge. Die Frauen, die mit dem Text in Berührung kommen, scheinen auf unheimliche Weise verwandelt zu werden. Die Außenwelt wird für sie unwichtig. Es zählt nur noch das Buch, sie folgen diesem Buch — bis in den Tod. Bis zum Jahr 1992 sind fünfzehn Selbstmorde zu verzeichnen, die eindeutig in Zusammenhang mit dem Text stehen. Die letzte Selbstmörderin ist die Frau des Verlegers.
Im Jahr 2004 machen sich ein Student und eine junge Kunstwissenschaftlerin auf nach Paris, um herauszufinden, was es mit der tödlichen Macht des Buches auf sich hat. Ihre Nachforschungen stiften jedoch noch mehr Verwirrung. Jeanne Saré, die jugendliche Schriftstellerin, scheint es nie gegeben zu haben…
Wer jedoch ist dann die Produzentin dieser dunklen Gedanken und abstrusen Geschichten? Wer hat Jeanne Saré, das dürre Mädchen mit dem kurz geschorenen Haar, das sich mit Spiegelscherben das Gesicht zerschneidet, Schaufensterpuppen in die Augen starrt und Bäckerlehringe verführt, erfunden, wenn nicht sie selbst es war? Etwa der Verleger, der sich seine etwas andere Traumfrau schaffen wollte, und mit seiner Verehrung dieses Phantasmas seine eigene Gattin in den Tod trieb? Ist Jeanne Saré das Produkt von Projektionen und Phantasien eines Mannes? Hat ein Mann diese Figur erschaffen, mit der sich Frauen bis hin zur Selbstaufgabe identifizierten?
Neben der Frage nach dem Autor oder der Autorin, der Frage nach Authentizität, geht es vor allem um eines: Schmerz. Um die Lust am Schmerz und die Schmerzen der Lust. Um Verletzung und Begierde, Erniedrigung und Hingabe, Ekel und Liebe. Lediglich im Schmerz scheinen die Figuren zu spüren, dass sie am Leben sind, in dem Schmerz, der sie schließlich doch tötet. Hier schreibt eine Frau von Gewalt. Die Frau ist nicht Opfer der Gewalt, die Frau ist zur Erzählerin der Gewalt geworden.
Nicht erwarten dürfen wir von Haratischwili jedoch einen so genial mitleidslosen Erzählgestus, wie wir ihn aus Eva Menasses „Lässlichen Todsünden” kennen. Das ist vielleicht genau der Punkt, den man Haratischwili vorwerfen kann: zuviel Pathetik, zuviel Dramatik.
Man merkt, dass Haratischwili vom Theater her kommt — auch an der Struktur des Romans. Im ersten Teil tritt eine begrenzte Anzahl von Personen an verschiedenen Schauplätzen, zu verschiedenen Zeiten auf. In sich abwechselnden Sequenzen werden die Köpfe und Körper der einzelnen Figuren von Haratischwili ausgeleuchtet. Im zweiten Teil verstricken sich die Geschichten ineinander, in Paris laufen die Linien zusammen.
Durch die langen Passagen wörtlicher Rede und allzu voraussehbare Fügungen der Handlung fühlt man sich jedoch manchmal eher an eine Seifenoper erinnert als an ein Theaterstück. Aus dem Stoff, den Haratischwili bearbeitet, hätte mehr herausgeholt werden können. Eine große Sprachkünstlerin ist sie nicht. Wen jedoch Sätze wie „Es war alles so verlogen” oder „…er begann ihren Körper mit seinen Händen zu kneten, als wolle er eine Skulptur erschaffen” nicht abschrecken, wird die großartig unheimliche Story genießen können.
PS.
Der Verlag hat mir, zu meiner Verwunderung, mit dem Rezensionsexemplar des Buches einige zusammengetackerte DinA‑4 Seiten mitgeschickt: einen Zeit-Artikel aus dem Jahr 1978 mit dem Titel „Ehre dem Tod”. Es handelt sich um eine Besprechung der deutschen Erstausgabe des in Frankreich erschienen Buches einer gewissen Danielle Sarréra. Hinter den Zeit-Artikel geheftet finde ich einen Wikipedia-Eintrag zu Danielle Sarréra, einer „fiktive[n] französischen Dichterin”, wie es darin heißt. Ihre Werke seien zeitweise dem Verleger Fredérick Tristan zugeschrieben worden, letztlich sei die Autorin oder der Autor des Textes aber bis heute unbekannt.
Haratischwilis geniale Story ist eine wahre Geschichte! Auch mich packt nun der Forschungsdrang.
Ich habe mir das Buch von Danielle Sarréra über ein Antiquariat im Internet bestellt.
Vermutlich werde ich mich nicht umbringen.
Nino Haratischwili: Juja
Verbrecher Verlag 2010
304 Seiten